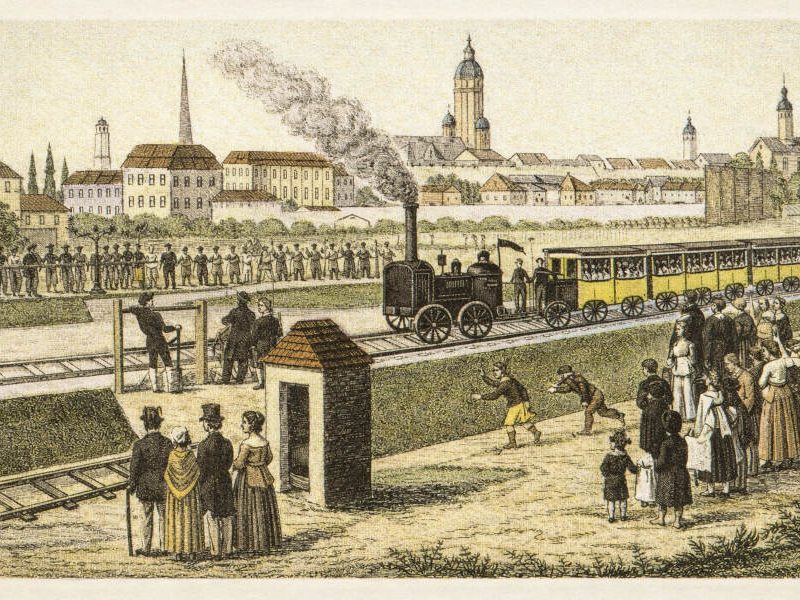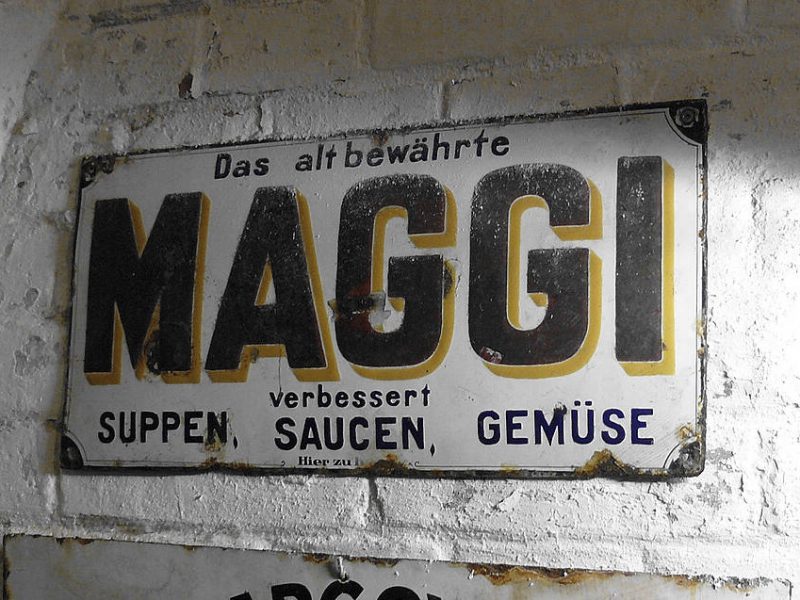Bild: Idealisiertes Symbobild eines Hauses der Vinca-Kultur (Donau-Zivilisation)
[Nacheiszeit] [Megalithkulturen] [mehr über die Donau-Zivilisation]
Meine Buchempfehlungen zum Beitrag [Werbung]: Das Rätsel der Donauzivilisation (Haarmann); Erinnerungen an Megalith-Europa (Tributsch); Der Untergang des Abendlandes (Spengler).
Vorbemerkung
➡️ Neulich befasste ich mich hier auf Inhortas.de mit den Thesen Oswald Spenglers über die Lebenszyklen von Hochkulturen bzw. Zivilisationen. Spengler ging davon aus, dass Kulturen wie lebendige Organismen entstehen, aufblühen, reifen und schließlich nach etwa 1000 Jahren unweigerlich vergehen. Er sprach von „Frühling“, „Sommer“, „Herbst“ und „Winter“ einer Zivilisation.
Ein Schlüsselbegriff bei Spengler ist das jeweilige „Symbol“ einer Kultur. Damit meinte er kein einzelnes Bildzeichen, sondern das Grundmuster, mit dem eine Zivilisation die Welt wahrnimmt und gestaltet. Man könnte sagen: Jede Kultur hat ein inneres Leitmotiv, das sich in Architektur, Religion, Kunst und Denken immer wieder widerspiegelt – wie ein Grundton, der alle Ausdrucksformen durchzieht. [1]
Anhand von sieben Kulturen, darunter die ägyptische, indische, chinesische und vor allem die griechisch-römische, entwickelte er sein Modell. Spenglers Gedankengang wurde später von anderen Denkern weitergeführt, etwa von Arnold Toynbee [2] oder Samuel Huntington [3] – und in jüngerer Zeit besonders von Prof. David Engels [4], der heute wohl der bekannteste Vertreter dieser Denkschule ist.
Mir fielen beim Studium dieser Thesen aber noch zwei besondere zivilisatorische Außenseiter auf, die bisher wohl noch nicht entsprechend analysiert und in die Reihe der „klassischen“ Hochkulturen eingegliedert wurden: die Donauzivilisation (auch Alteuropa genannt) [5] und die westeuropäische Megalithkultur [6].
Betrachtet man sie jedoch mit spenglerischem Blick, so lichtet sich der mystische Schleier, der oft über ihnen liegt. Statt bloß rätselhafter Fragmente treten sie als das hervor, was sie auch waren: vollwertige Hochkulturen mit eigenem inneren Lebensrhythmus.
Der einzige Unterschied: Diese beiden Kulturen folgten zwar demselben inneren Rhythmus, doch ihre Lebenszyklen dauerten wesentlich länger als die von Spengler angenommenen 1000 Jahre.
Die Donauzivilisation
… und ihr inneres geistiges Leitmotiv (Kultursymbol):
„Das Gewebe der Gemeinschaft und sein Zerreißen“
Frühling (6500–5500 v. Chr.)
🔸 Die Donauzivilisation entstand aus den frühen sesshaften Bauern Anatoliens, die sich zunächst in der thessalischen Ebene (Griechenland) niederließen und ein funktionales Gemeinwesen errichteten. Es entstanden rechteckige freistehende Häuser, die sich zu kleinen Dörfern mit demokratischen Strukturen formten. Die Seefahrt ist bekannt und der Seehandel wird vermutet [6a].
Diese Gemeinschaften ehemaliger anatolischer Bauern gerieten nach ihrer ersten Formierung jedoch in bewegte zeiten, denn sie wurden bald mit einem plötzlichen weltweiten Kältesturz konfrontiert – dem sogenanntn 8.2-Ereignis, das mit der „Sintflut“ am Schwarzen Meer in Verbindung gebracht wird. Anschließend folgte die Ausbreitung entlang der Donau und der Nebenflüsse, begleitet von der Vermischung mit einheimischen Jäger- und Sammlerkulturen. Triebkräfte waren Bevölkerungswachstum und der „neolithische Wohlstand“.
🔸 Es entwickelte sich eine bemerkenswert friedvolle Kultur: keine Waffen als Grabbeigaben, keine ausgeprägten gesellschaftlichen oder geschlechtlichen Hierarchien – vielmehr scheint man Gleichrangigkeit gelebt und geduldet zu haben.
🔸 Dorfgemeinschaften gründeten sich, und frühzeitig entwickelte sich neben der Landwirtschaft auch das Handwerk: Weberei, kunstvolle Keramik und tönerne Figurinen als Ausdruck der „Großen Einheit“.
Diese Figurinen (Kleinplastiken) der „Großen Mutter“ sind mehr als vermeintliche Fruchtbarkeitssymbole – sie verweisen auf eine spirituelle Idee, die fast wie eine frühe Form des Monotheismus wirkt: nicht viele Götter, sondern eine einzige, alles durchwirkende Urkraft, die in unzähligen Gestalten sichtbar wird [7].

Sommer (5500–4500 v. Chr.)
🔸 Die Kultur erreichte ihre Blütezeit. Der Pflug wurde erfunden, Ochsen dienten nun als Transport- und Zugtiere. Die Donau und ihre Nebenflüsse verwandelten sich in die Autobahnen des Handels. Weitgespannte Netzwerke von Dörfern tauschten Keramik, Obsidian, Salz – und nicht zuletzt Ideen. Schmuck, vielfältige Gebrauchsgüter, Rollsiegel, Zahlennotationen und sogar eine eigene Schrift entstanden – mehr als 3000 Jahre vor Ägyptern und Sumerern.

🔸 „Die Alteuropäer kannten bereits Einfamilienhäuser mit über 100 Quadratmetern Grundfläche – ein bemerkenswerter Luxus für jene Zeit.“ (Harmann [6], Seite 11)
🔸 Die künstlerische Formensprache wurde komplexer, zugleich aber von immer wiederkehrenden Mustern geprägt: Spiralen, Bänder, geometrische Rhythmen. Man kannte bereits einfache Formen der Töpferscheibe, das Töpferrad und hochentwickelte Brennöfen. Ebenso wurde das Schmelzen von Kupfer aus Erzgestein und der Metallguss erfunden. Werkzeuge und Gebrauchsgegenstände aus Metall wurden gefertigt und gehandelt.
🔸 Diese Epoche war von einer erstaunlichen Beständigkeit geprägt – ein Hinweis auf eine tiefe geistige Grundhaltung: Alles ist miteinander verwoben.
Herbst (4500–4000 v. Chr.)
Hier beginnen die Erstarrungen.
🔸 Die Keramik wird zwar reicher im Ornament, doch zugleich uniformer – das kreative Spiel weicht einem starren Kanon.
🔸 Auch die Figurinen verlieren ihre Vielfalt. Immer öfter gleichen sie sich einander an, als ob das Symbol der „Großen Göttin“ nur noch mechanisch reproduziert, nicht mehr innerlich erlebt würde.
🔸Gleichzeitig treten Befestigungen und Großsiedlungen auf: Das egalitäre Gewebe der kleinen Dörfer zieht sich zusammen, Macht und Besitz beginnen sich zu konzentrieren.
🔸 Erste soziale Unterschiede werden sichtbar. Der ursprüngliche Gedanke der Verbundenheit gerät in Spannung zu neuen Kräften: Kontrolle, Abgrenzung, Schutz.
Winter (ab 4000 v. Chr.)
In dieser Spätphase wirkt eine Zivilisation allgemein gesehen äußerlich noch kraftvoll – mit Weltstädten, imperialer Ausbreitung und mit technischen Höchstleistungen (wie in der heutigen westlichen Kultur) – doch innerlich ist sie ausgelaugt. So auch in Alteuropa.
🔸 Die Kultur ist innerlich erschöpft. Der monistische Geist, das Gefühl des großen Gewebes, hat sich in bloße Formen und rituelle Wiederholungen verwandelt. Dennoch entstehen gerade jetzt Megasiedlungen: In der größten, Tallyanky, lebten schätzungsweise 10.000 Menschen. Archäologen fanden dort zweistöckige Reihenhäuser – ein städtebauliches Novum. Rad und Wagen wird, wohl in Kooperation mit den Viehnomaden erfunden.
🔸 Zugleich dringen aus dem Osten – aus den Steppengebieten – immer mehr indoeuropäische Gruppen (Hirtennomaden) in das Alteuropa ein, das nicht mehr lebendig ist. In der bisher egalitären Gesellschaft bildet sich eine neue Aristokratie heraus, die das einst blühende Netzwerk schleichend zersetzt – meist ohne offene Gewalt oder Brandschatzung.
Mit dem Beginn der Bronzezeit in Südosteuropa (Balkan, Karpatenbecken) um ca. 3300 v. Chr. verliert die Zivilisation zunehmend an Sichtbarkeit: Ein markantes Zeichen ist das Auslaufen der Schriftverwendung, die über Jahrtausende gepflegt worden war.
In diese Zeit (Beginn der Bronzezeit) fällt auch die Nutzung des Pferdes als Reittier durch die indogermanische Jamnaja-Kultur (Hirtennomaden). Dadurch gewannen sie eine neue Form der Mobilität und militärischen Überlegenheit, die es ihnen erlaubte, als neue Elite ihre Vorstellungen von Herrschaft in anderen Kulturen durchzusetzen – Kulturen, die nicht in der Lage waren, sich diesem tiefgreifenden Wandel flexibel anzupassen.
🔸 Doch nichts geht restlos verloren: Es kommt zu einer Kulturdiffusion (Kulturdrift) in den Balkan, nach Kreta und in die späteren griechischen Gebiete. Dort beginnt das Spiel der Zivilisationszyklen von Neuem – getragen von den Impulsen, die einst im alten Donauraum ihren Ursprung nahmen.
Die europäische Megalithkultur
… hier auf inhortas.de erwähnt, mit ihrem inneren geistigen Leitmotiv (Kultursymbol):
„Der Kreis und seine Versteinerung“
Frühling (4500–4000 v. Chr.)
🔸 In den Dörfern West- und Nordeuropas entstehen die ersten Dolmen und kleinen Steinsätze. Sie sind noch schlicht, aber von tiefer Bedeutung: Der Kreis der Steine markiert die Gemeinschaft und ihre Verbindung zum Kosmos.
Sommer (4000–3000 v. Chr.)
🔸 Die Kultur entfaltet ihre volle Kraft. Riesige Megalithanlagen wie in Carnac, auf den Orkneys oder in Südengland entstehen. Die Ausrichtungen nach Sonne und Mond spiegeln ein zyklisches Weltgefühl: Alles kehrt wieder, die Zeit selbst ist ein Kreis.

Herbst (3000–2500 v. Chr.)
🔸 Nun treten die Erstarrungen ein. Die Bauwerke werden monumentaler, aber auch immer standardisierter: Dolmen, Ganggräber, Henge-Anlagen folgen festen Mustern.
🔸 Rituale scheinen stärker formalisiert, weniger Ausdruck lebendiger Gemeinschaft, mehr „Pflicht“.
🔸 Gleichzeitig wächst die soziale Ungleichheit – Eliten beginnen, die Megalithanlagen für ihre Legitimation zu nutzen. Der Kreis, ursprünglich Symbol der Einheit, wird nun zum Statussymbol und Abgrenzungsmerkmal (Distinktionszeichen).

Winter (ab 2500 v. Chr.)
🔸 Mit der Bronzezeit und der infiltration durch die Indoeuropäer (Glockenbechern) endet die Megalithkultur. Nicht durch plötzliche Vernichtung, sondern durch Verblassen: Der Kreis verliert Bedeutung, die Steine stehen als leere Monumente in der Landschaft. Die Spiritualität ist erstarrt, bevor der äußere Wandel sie verdrängt [9].
Allerdings: Wohin es die Megalithiker weltweit auch hinverschlagen haben mag, auf Sardinien lebte die Megalithkultur minimiert in einzigartiger Form weiter, getragen von einer Händlerelite, die den Obsidianhandel vom Monte Arci kontrollierte – nicht Phönizier, die erst Jahrhunderte später kamen, sondern lokale neolithische und bronzezeitliche Gemeinschaften. Diese mündeten in die Nuraghenkultur, die bis ins 2. Jahrhundert v. Chr. Bestand hatte. Doch das ist eine andere Geschichte [10].
Ein gemeinsames Muster
Ob Donau- oder Megalithkultur: Beide gingen vermutlich nicht primär durch äußere Gewalt zugrunde. Sie erlebten einen inneren Tod durch Erstarrung.
🔸 In der Donauzivilisation erstarrte ein offensichtlich einmaliges, in sich anfangs fest verwobenes Gemeinwesen.
🔸 In der Megalithkultur verhärtete der Kreis der Gemeinschaft zu monumentalen Steinkreisanlagen, die Ursprungskraft vorgeben, doch nicht mehr besitzen.
Durch diese stagnierenden Strukturen, die einst das Wesen dieser Hochkulturen prägten, entstand ein geistiges Vakuum, das zwangsläufig gefüllt wurde. Indoeuropäische Stämme rückten nach und überformten die entstandene Leere. Sie waren nicht die Ursache, sondern die Vollstrecker des Zerfalls – ähnlich wie später die Germanen Rom besiegelten, das innerlich längst erloschen war.
Eine scheinbare Neubelebung brachte das römisch-germanische Christentum, das zunächst eine Pseudomorphose blieb – eine Scheinkultur ohne eigene Seele. Erst im Frühmittelalter erwachte die abendländische Hochkultur durch eine Kulturdrift, wie sie Harald Haarmann für die Donauzivilisation beschreibt ([6] Das Rätsel der Donauzivilisation, S. 236 ff.), und fand im Sinne Goethes zu ihrer faustischen Gestalt.
Quellen und Erläuterungen
Bildquellen
- 2) https://commons.wikimedia.org/wiki/File: Vinca_ceramics_1c.jpg
- 3) https://de.wikipedia.org/wiki/ Tontafeln_von_T%C4%83rt%C4%83ria
- 4) KI-Symbolbild, mehr zum Thema: https://de.wikipedia.org/wiki/Newgrange
- https://commons.wikimedia.org/wiki/File: Vincanska_kuca1.jpg, Bild unten: Haus einer Vinča-Familie:

[1] Oswald Spengler ordnet in seinem Werk Der Untergang des Abendlandes verschiedenen Zivilisationen sogenannte „Ursymbole“ zu, die ihrer kulturellen und geistigen Essenz Ausdruck verleihen. Hier sind die von ihm beschriebenen Hochkulturen und ihre jeweiligen Symbole:Ägyptische Kultur: Das Symbol ist der Weg. Es repräsentiert die strenge Linearität und das Streben nach einem klar definierten Ziel, das sich in der Architektur (z. B. Pyramiden) und der statischen Weltanschauung zeigt.
- Babylonische Kultur: Das Symbol ist die Mauer. Sie steht für die Abgrenzung und das Bedürfnis nach Schutz sowie die zentrale Rolle von Städten und Festungen.
- Indische Kultur: Das Symbol ist die Welt als Traum oder die Null. Es spiegelt die spirituelle Orientierung, die Verneinung der materiellen Welt und die Betonung des Nirwana wider.
- Chinesische Kultur: Das Symbol ist der Tao oder die Wanderung im Einklang. Es steht für die harmonische Anpassung an die Natur und die zyklische Auffassung von Zeit und Leben.
- Apollinische Kultur (griechisch-römisch): Das Symbol ist der Körper oder die plastische Form. Es betont die sichtbare, begrenzte Form, wie sie in der klassischen Kunst (Statuen, Tempel) und der statischen Weltanschauung zum Ausdruck kommt.
- Magische Kultur (nahöstlich, frühchristlich, islamisch): Das Symbol ist die Kaverne oder der Hohlraum. Es verweist auf die mystische Innenwelt, die spirituelle Tiefe und die Verbindung zwischen Himmel und Erde, wie in Kuppeln von Moscheen oder Kirchen.
- Faustische Kultur (westlich-abendländisch): Das Symbol ist der unendliche Raum. Es steht für das Streben nach Unendlichkeit, Dynamik und Fortschritt, sichtbar in gotischen Kathedralen, Perspektive in der Malerei und der expansiven Wissenschaft.
- Maya-Kultur: Das Symbol ist die Zeit oder der Kalender. Die Maya-Kultur war stark auf präzise Zeitmessung und kosmische Zyklen fokussiert, was sich in ihren Kalendern und Tempeln zeigt.
[2] Arnold J. Toynbee (1889–1975) war ein britischer Historiker, der in seinem monumentalen Werk „A Study of History“ (1934–1961, zwölf Bände) die Entwicklung von mehr als zwanzig Zivilisationen beschrieb. Anders als Spengler betonte er dabei die Rolle kreativer Eliten und das Prinzip von „Herausforderung und Antwort“ als Motor kultureller Entwicklung. ↩
[3] Samuel P. Huntington (1927–2008) war ein US-amerikanischer Politikwissenschaftler, bekannt durch sein Werk „The Clash of Civilizations“ (1996). Er knüpfte an spenglerisch-toynbeeartige Überlegungen an, indem er prognostizierte, dass die Konflikte der Zukunft weniger von Ideologien, sondern vor allem von kulturell-zivilisatorischen Unterschieden geprägt sein würden.
[4] David Engels (geb. 1979) ist ein belgischer Althistoriker und Kulturphilosoph. Er lehrte zunächst Alte Geschichte an der Universität Brüssel und arbeitet heute am „Instytut Zachodni“ in Posen. Bekannt wurde er mit seinem Buch „Auf dem Weg ins Imperium. Die Krise der Europäischen Union im Lichte des Untergangs der Römischen Republik“ (2014), in dem er Parallelen zwischen der EU und der römischen Spätzeit zieht. Engels sieht Europa – ganz im spenglerschen Sinne – am Übergang von einer Kultur zur Zivilisation und interpretiert aktuelle Krisen als Anzeichen dieser Transformation.
[5] Die Donauzivilisation halte ich schon deshalb für interessant, weil dort offensichtlich der Pflug erfunden wurde. Allgemein ist das derzeit im Schul-und Wikipedia-Wissen allerdings noch nicht anerkannt, obgleich die Wissenschaft da schon viel weiter ist.
[6] HAARMANN, Harald; Das Rätsel der Donauzivilisation · Die Entdeckung der ältesten Hochkultur Europas; München 2017
[6a] „Es sind zwar keine Reste prähistorischer Boote gefunden worden, die Hinweise auf die Bauart von seetauglichen Fahrzeugen geben könnten, aber klare Indizien sprechen dafür, dass die Jäger und Sammler des Mesolithikums (mittlere Steinzeit) die an der Westküste der Ägäis lebten, sich auch in küstennahen Gewässern bewegt haben. An den Lagerplätzen hat man Reste von Thunfisch gefunden, der nur in offenen Gewässern gefangen werden kann. Die Menschen der mittleren Steinzeit waren aber nicht nur geschickte Fischer, sie waren auch die ersten, die Handelsrouten über See erkundeten“ (Haarmann [6] Seite 15)
[7] Der Begriff der „Großen Mutter“ wurde in der Archäologie besonders durch Marija Gimbutas (1921–1994) geprägt und popularisiert. In ihren Werken (The Goddesses and Gods of Old Europe, 1974; The Language of the Goddess, 1989) deutete sie die Figurinen Alteuropas als Ausdruck einer umfassenden weiblichen Gottheit, die Geburt, Tod und kosmische Ordnung vereinte.
[8] Die westeruopäischen Megalithiker – nach Helmut Tributsch sind es die legänderen Atlanter – in dieser Kultur vermute ich die gärtnerische Kultur von Allium ampeloprasum, dem Ackerlauch.
[9] Archäologen wie Colin Renfrew (Before Civilization, 1973) betonen, dass die Megalithkultur nicht durch plötzliche Zerstörung, sondern durch allmähliche Transformation (z. B. durch Handel, Migration) endete. Die Steinkreise blieben als Relikte, aber ihre kulturelle Funktion schwand.
[10] BADING, Ingo; Rebellen und Könige – Die Indogermanen [auf Sardinien]; 21.8.2021 (in den Webarchiven)
[11] PODBREGAR, Nadja; scinexx.de; Die ersten Städte Europas · Auf Spurensuche in den Trypillia-Megasiedlungen der Kupfersteinzeit; 28.2.2025 (die Cucuteni-Tripolje-Kultur war Teil der Donauzivilisation; im umfangreichen Beitrag ist Aufstieg und Niedergang der sogenannten Megasiedlungen beschrieben)