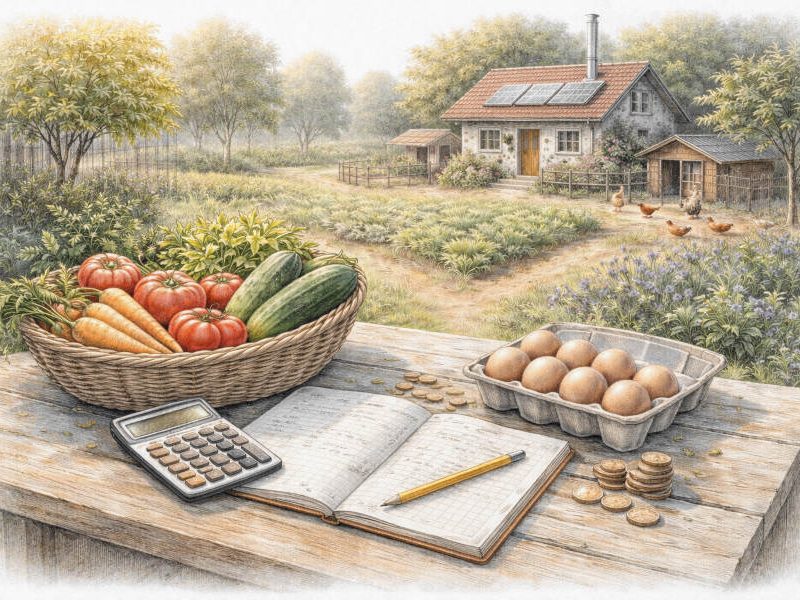Bild: Stillleben mit Rettich und Radieschen (um 1880) von der österreichische Malerin Emilie Mediz-Pelikan (1861–1908)
[Regional]
Ich hatte schon immer einmal vor, mich etwas intensiver mit dem bayerischen Radi zu beschäftigen und darüber zu schreiben. Doch hielt mich bisher irgendeine heilige Furcht davon ab, als Sachse über dieses Thema zu publizieren – und nun wird es wohl eine kulturelle Aneignung werden.
Auf der anderen Seite scheinen es die Bayowaren mit ihrem Radi selbst nicht mehr ganz so ernst zu nehmen. Denn die Produktion dieser doch sehr speziellen deutschen regionalen Rettich-Varietät wird wohl bald im Nirvana verschwinden.
Die Funktionäre der Europäischen Union und ihr nachgelagerter Beamtenstaat haben nämlich in ihrer unendlichen Weisheit beschlossen, die alte Sorte „Münchener Bier“ nicht mehr als handelbare Sorte zuzulassen [1].
Der Radi im Biergarten – mehr als nur Beilage
Doch mal ernsthaft – das Thema Rettiche und Biergarten ist um vieles vielschichtiger, als man glauben mag. Und ich weiß gar nicht so recht, wo ich damit anfangen soll [2].
In Vorträgen wählt man im einfachsten Falle ein Zitat. Im Zusammenhang mit dem besagten Rettich ist das folgende angebracht:
„Der Radi muss weinen.“
(Weinen könnte ich allerdings bei diesem Thema, weil es den echten Radi in den Wirtschaften gar nicht mehr gibt.)
Gemeint ist aber – also was die Tränen betrifft – dass der aufgeschnittene Radi gesalzen wird, wodurch dann etwas Flüssigkeit austritt. Das mildert die Schärfe.
Das Salz wiederum – in Verbindung mit dem „Basengemüse“ – macht, so munkelt man, den anschließenden Konsum von Bier etwas bekömmlicher [3]. Eine Erkenntnis, die übrigens auch der bayerischen Breze nicht fremd ist.
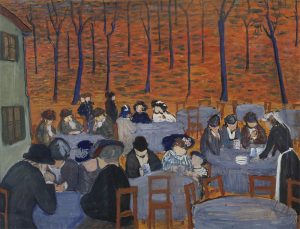
Der „Münchener Bier“ – eine regionale Sorte mit Geschichte
Nun ist dieser ‚Münchener Bier Rettich‚ nicht irgendein Radi.
Tatsächlich kam man im 19. Jahrhundert gezielt auf die Idee, lange, milde Rettiche zu züchten [2], die im Spätsommer und Frühherbst geerntet werden konnten – genau zur Zeit der Kirchweih- und Erntefeste.
Die wachsende Zahl an Biergärten in München und Umgebung (seit etwa 1810, nach der Einführung des untergärigen Bieres) sorgte für eine starke Nachfrage nach würziger, aber erfrischender Rohkost zum Bier.
Der Radi passte perfekt: Er wuchs schnell und war im Juli/August als Nachkultur einfach anzubauen. Er ließ sich frisch auf den Markt bringen – ideal für lokalen Verkauf. Und er harmonierte geschmacklich wunderbar mit Bier, Salz, Brezn und Käse.
So wurde der Radi zur typischen Biergartenspezialität und erhielt seine feste Jahreszeit: die Wochen zwischen Ernte und Kirchweih – also Spätsommer bis Frühherbst.
Er ist eine Sorte, die seit Generationen an das lokale Klima und den Freilandanbau im Sommer angepasst ist. Er wächst zuverlässig unter bayerischer Sonne, schießt nicht gleich in die Blüte, und sein fester, würziger Geschmack passt perfekt zum Biergarten.
Er war also immer das, was man heute gerne „regional“ nennt – lange bevor das Wort in Imagekampagnen auftauchte.

Daikon statt Radi – Globalisierung im Gartenbeet
Doch die Welt hat sich verändert. Und so hat auch der Radi einen globalisierten Bruder bekommen: den japanischen Daikon.
Botanisch eng verwandt, aber sonst das genaue Gegenteil.
Der Daikon liebt für seine Kultur die kurzen Tage des Spätsommers, wurde für die Nachfrucht-Kultur nach Reis gezüchtet und dient in Ostasien vor allem im Herbst der Fermentation – für Kimchi oder Tsukemono [4].
Heute jedoch verdrängen seine Hybridsorten mehr und mehr den Münchener Bier vom Markt.
Weil sie gleichmäßiger sind.
Ertragreicher.
Und für die industrielle Landwirtschaft und für den Handel besser handhabbar.
Zwischen Kimchi und Bierkrug
Und so geschieht das Paradoxe:
Der Radi, Inbegriff des bayerischen Biergartens,
wird nun von einer Sorte ersetzt, die ursprünglich für koreanisches Kimchi – also Sauerkraut – gedacht war.
Der Geschmack bleibt vielleicht ähnlich – doch das, was ihn umgab, die regionale Kultur, die Kreisläufe, die Eigenart, das geht still verloren.
Natürlich kann man sagen:
Was soll’s, Hauptsache, der Radi knackt.
Aber man könnte auch fragen, ob es uns nicht etwas angeht, wenn das, was einst aus der Region für die Region wuchs, heute aus globalem Saatgut stammt – dessen Wurzeln eher in der Saatgutindustrie liegen als im bayerischen Boden.
Ein stilles Verschwinden
Vielleicht sollte man das tolerieren.
Vielleicht gehört es einfach zum Lauf der Zeit.
Aber es wäre schade,
wenn man eines Tages im Biergarten sitzt, Radi isst –
und erst dann merkt,
dass man längst am Nebentisch der Globalisierung Platz genommen hat.
Oder: wir sehen uns gleich in Korea zum Oktoberfest im „Deutschen Dorf“ [5] wieder, womit ich den Blogartikel dann doch mit einem versöhnlichen Gedanken schließen kann…
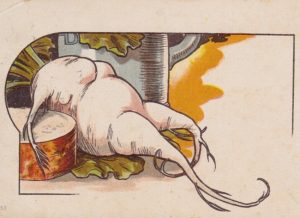
Quellen und Literatur
[1] „Die namensgebende Sorte des Münchner Bierrettich wurde Ende 2007 aus den EU-Sorten-Katalogen gestrichen.“
Quelle: VORDERWÜLBECKE, Birgit und KOLLER, Beate; Die Schönheit der Rettiche“; ARCHE NOAH Magazin · Dezember 2008; https://www.arche-noah.at/media/arche_noah_magazin_4_08_screen.pdf
Wenn der „Münchener Bier“ nicht mehr gelistet ist, heißt das zwar nicht, dass er nicht mehr existiert – aber dass er im kommerziellen Anbau keine Rolle mehr spielt und nur durch engagierte Erhalter, Initiativen oder private Gärtner weitergegeben wird.
[1b] BECKER, Hans-Georg; welt.de; Der „Münchener Bierradi“ muss gerettet werden; 26.06.2000
[2] Die alten mitteleuropäischen Rettichsorten wurden oft auf besondere Art und Weise und regional angebaut. In Bayeren kamen sie beispielsweise aus Weichs und Reinhausen (heute in Regensburg eingemeindet), wo namentlich „Rettich- und Gemüsegärtnereien“ vorzufinden waren. Eine Besonderheit der Bayrischen Varietäten war etwa, dass sie verpflanzt werden konnten. Ich werde das Thema zum Rettich-Anbau im 19. Jahrhundert sicher noch separat ausarbeiten. Hier noch eine Quelle:
Dr. Neubert’s Deutsches Garten-Magazin XLV. Jahrgang; München 1892; S. 131; im Artikel von
BURKHARDT, Ferdinand Theodor; „Winke zur Gemüsezucht“ ab S. 128
[3] Ob Salz und Basengemüse die Wirkung von Alkohol wirklich mildern, darüber ließe sich trefflich streiten. Fakt ist: Salz regt die Flüssigkeitsaufnahme an und verzögert so ein wenig die Alkoholaufnahme, während Rettich durch seine Mineralstoffe und Senföle die Verdauung und Leberarbeit unterstützt. Zusammen ergibt das, was man in Bayern wohl „g’scheit bekömmlich“ nennen würde – wissenschaftlich nicht zwingend belegt, aber praktisch plausibel.
[3b] Der Radi im Gebrauch vor Ort: eine kurze Doku auf YouTube.
[4] Tsukemono (漬物) bedeutet wörtlich „Eingelegtes“ oder „eingelegtes Gemüse“. Es ist ein Oberbegriff für japanische Pickles, also für alles, was durch Salzen, Einlegen oder Fermentieren haltbar gemacht wird.
[5] Das „Deutsche Dorf“ findet sich in Südkorea in Samdong-myeon, Namhae-gun, in der Provinz Gyeongnam-do.
[6] LABER H. / LATTAUSCHKE G.; Gemüsebau; Stuttgart (Hohenheim) in mehreren Auflagen
[7] Bayerischer Rundfunk (YouTube); „Brotzeit-Klassiker: Der letzte Radi aus Regensburg | Zwischen Spessart und Karwendel“; 19.6.2020
—
Bildquellen
- 1) https://commons.wikimedia.org/wiki/File: Emilie_Mediz-Pelikan_(attr)_ Stillleben_mit_Rettich_und_Radieschen.jpg
- https://de.wikipedia.org/wiki/Emilie_Mediz-Pelikan
- 2) https://commons.wikimedia.org/wiki/File:WerefkinBiergarten.jpg
- https://de.wikipedia.org/wiki/Marianne_von_Werefkin
- 4) https://commons.wikimedia.org/wiki/File: Weiblicher_Rettich._Postkarte,_c_1918.jpg