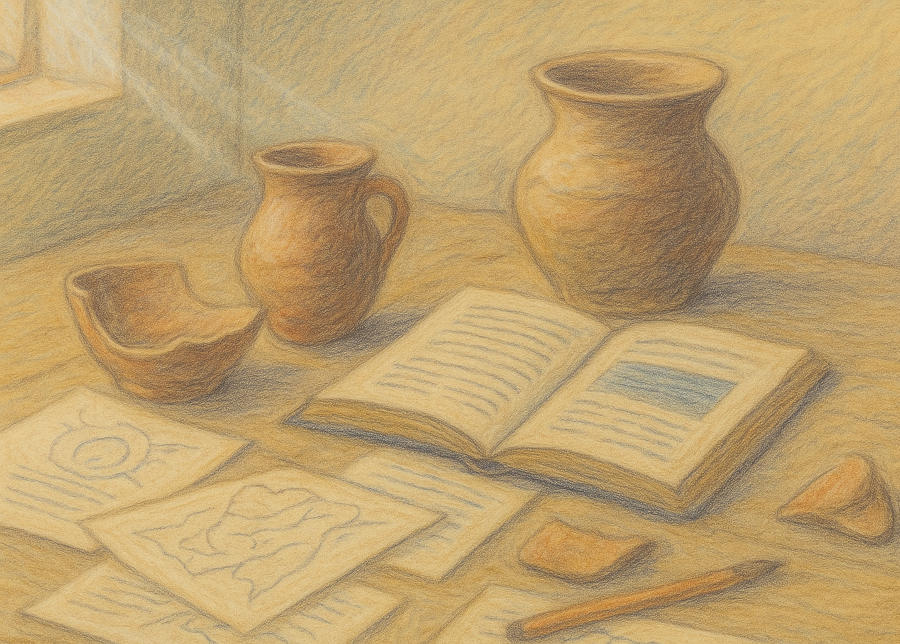[Beitrag in Erstellung]
Völkerkunde, Vorgschichte, Agrargeschichte usw. – wie entsteht Wissen, was uns präsentiert wird?
Ein Angebot
➡️ Dieser Artikel soll Lesern helfen, den Prozess der Wissensbildung in Geschichte, Archäologie und ihren naturwissenschaftlichen Nachbarfeldern besser zu verstehen – und damit ein Werkzeug an die Hand geben, um die unterschiedlichen Publikationen aus diesen Bereichen schneller einordnen zu können.
![]() Ich selber verwende das von mir entwickelte Konzept als eine Art Markersystem, um die verschiedensten Publikationen und Meinungsäußerungen sachlich und schnell einordnen zu können. In meinem Fall sind das vordergründig die Recherchen zur Wirtschafts- und Agrargeschichte [1].
Ich selber verwende das von mir entwickelte Konzept als eine Art Markersystem, um die verschiedensten Publikationen und Meinungsäußerungen sachlich und schnell einordnen zu können. In meinem Fall sind das vordergründig die Recherchen zur Wirtschafts- und Agrargeschichte [1].
Meine Deutungs-Matrix, die ich für meine eigene Arbeit nutze, bietet mir eine Struktur, um den Weg von Daten zu Wissen zu überblicken – und zugleich eine Einladung, kritisch und entspannt mit Deutungen und Sinngebungen umzugehen.
Die Deutungs-Matrix: Wie Geschichte und Archäologie Wissen formen
➡️ Geschichte und Archäologie sind faszinierende Disziplinen, weil sie aus materiellen und textlichen Spuren Erzählungen über die Vergangenheit formen. Doch wie genau entsteht aus Funden, Dokumenten und Messwerten Wissen?
Diesen Prozess lässt sich in drei Phasen gliedern: Datensammlung, Ordnung und Publikation sowie Interpretation. Gemeinsam bilden sie das, was ich als Deutungs-Matrix bezeichne – ein Rahmen, der sichtbar macht, wie aus Fakten Sinn wird und warum Deutungen stets mehr sind als reine Wissenschaft.
1. Datensammlung: Die Grundlage der Forschung
🏺 Am Anfang steht im Wissenschaftsbetrieb – oder außerhalb davon – die Erhebung von Daten.
In der Archäologie sind es Artefakte – Scherben, Werkzeuge, Skelette – in der Geschichtswissenschaft Quellen wie Briefe, Verträge oder Chroniken. Hinzu kommen naturwissenschaftliche Methoden, etwa Radiokarbon-Datierungen oder DNA-Analysen, die präzise Fakten liefern.
Diese Phase scheint zunächst objektiv: Ein Topf ist ein Topf, ein Datum ein Datum. Doch schon hier fallen Entscheidungen – was wird untersucht, was bleibt unbeachtet? Welche Fragen lenken den Blick?
Die Datensammlung legt den Grundstein, aber sie ist nie neutral: Jede Auswahl setzt bereits einen Rahmen.
2. Ordnung und Publikation: Struktur ins Chaos bringen
🧩 Nach der Datensammlung folgt die Phase des Ordnens und Publizierens. Gefundene Objekte werden katalogisiert, Quellen thematisch oder chronologisch geordnet, Datenbanken erstellt.
Dieser Schritt ist entscheidend, um Rohdaten zugänglich und nutzbar zu machen. Ein Archäologe kann Funde digital erfassen, ein Historiker Quellen in einem Aufsatz zusammenführen. Die Veröffentlichung – ob in Fachzeitschriften, Büchern oder online – verleiht den Daten Autorität und Sichtbarkeit.
Doch auch hier findet Selektion statt: Welche Daten werden hervorgehoben, welche bleiben im Hintergrund? Ordnung ist nie nur Verwaltung, sondern bereits Gestaltung – und sie beeinflusst, wie Daten später gedeutet werden.
Oft sind Ordnung, Strukturierung und Interpretation eng miteinander verwoben. Ich trenne sie hier analytisch, doch in der Praxis bedingen sie sich gegenseitig: Schon die Struktur kann eine Deutung enthalten.
3. Interpretation: Sinn aus Fakten schaffen
🧙 Die dritte Phase der Deutungs-Matrix ist die Interpretation, in der die Daten Bedeutung erhalten. Hier entstehen die Geschichten, die wir über die Vergangenheit erzählen.
Ein Topf wird zum Zeugnis einer Handelskultur, ein Skelett erzählt von Migration oder Krankheit.
Doch Interpretation ist kein neutraler Vorgang. Sie hängt ab von der Perspektive des Forschers, seinem kulturellen Hintergrund, seinen Fragestellungen – und manchmal auch von Erwartungen der Öffentlichkeit.
Akademiker besitzen hier meist die Deutungshoheit, da sie methodisch geschult sind, Daten in Kontexte zu setzen. Doch gerade darin liegt Spannungspotenzial: Deutungen entstehen nie im luftleeren Raum.
Zweckdeutung und Sinnstiftung
Warum deuten wir überhaupt?
➡️ Hinter jeder Interpretation steht ein Zweck – und oft auch ein Sinn. Beides ist nicht dasselbe, auch wenn sie sich überlagern.
Zweckdeutung beschreibt, warum etwas gedeutet wird – also das bewusste oder unbewusste Ziel einer Interpretation. Sinnstiftung dagegen beschreibt, welchen inneren oder gesellschaftlichen Sinn eine Deutung erfüllt.
Ein und dieselbe Interpretation kann also verschiedene Zwecke verfolgen:
- Wissenschaftlich: Rekonstruktion der Vergangenheit nach methodischen Kriterien.
- Kulturell: Stärkung kollektiver Identität oder Traditionspflege.
- Politisch: Legitimation von Ansprüchen oder Ideologien.
- Persönlich: Verbindung zur eigenen Biografie oder Herkunft.
- Religiös/Esoterisch: Einordnung in ein spirituelles Weltbild.
- Ökonomisch: Vermarktung, Aufmerksamkeit, Profitorientierung. Und als anderes Extrem:
- Sozial (kommunikativ): Deutung als Mittel sozialer Interaktion – zur Verständigung, Positionierung oder Beziehungspflege.
Jeder Zweck erzeugt seine eigene Form von Sinnstiftung.
➡️ So folgt auf die Zweckdeutung oft eine zweite Ebene: die Suche nach Bedeutung, die dem Leben, der Gemeinschaft oder der Welt einen Zusammenhang verleiht.
Ein Beispiel:
Ein Archäologe kann ein prähistorisches Skelett als wissenschaftliches Beweismaterial betrachten – während eine lokale Gemeinschaft darin den Ahnen eines mythischen Ursprungs sieht.
Beide Deutungen erfüllen verschiedene Zwecke und stiften unterschiedlichen Sinn.
Problematisch wird es erst, wenn diese Perspektiven nicht transparent gemacht werden.
Konflikte durch Deutungshoheit
➡️ Wenn verschiedene Deutungszwecke aufeinandertreffen, entstehen Konflikte – besonders dort, wo jemand in die Deutungshoheit eines anderen eingreift.
Ein klassisches Beispiel sind archäologische Funde in politisch sensiblen Regionen: Mehrere Gruppen beanspruchen dieselben Artefakte, weil sie jeweils einen anderen Sinn darin sehen. Ohne klare Kommunikation über den Zweck der Deutung fühlen sich Perspektiven schnell bedroht – und wissenschaftliche Diskussionen geraten in emotionale oder ideologische Auseinandersetzungen.
Doch dieses Phänomen betrifft nicht nur den Gegensatz zwischen Wissenschaft und Esoterik.
Auch wissenschaftliche Deutungen selbst können kulturell, ideologisch, politisch oder wirtschaftlich unterwandert sein.
Als wirtschaftlich freier Journalist beobachte ich, dass in allen Milieus – akademisch wie außermethodisch – Deutungen oft sehr unterschiedlichen Interessen folgen. Mitunter hilft es, etwas Gespür für den „Stallgeruch“ und die ausgesprochenen wie unausgesprochenen Zwänge einer wissenschaftlichen Umgebung zu entwickeln. Im einfachsten Fall fällt es schon auf, wenn die unselige Gendersprache Einzug hält oder ähnliches.
Das ist kein Vorwurf, sondern eine Erinnerung daran, dass jede Interpretation in einem sozialen und beruflichen Umfeld entsteht, das bestimmte Sichtweisen begünstigt – und andere leise ausschließt.
Transparenz als Schlüssel
Ein möglicher Weg, solche Konflikte zu entschärfen, liegt in Transparenz:
➡️ Wenn der Zweck einer Deutung offen benannt wird, können Missverständnisse reduziert und Dialoge auf Augenhöhe geführt werden.
Die Deutungs-Matrix kann hier helfen, weil sie den gesamten Prozess sichtbar macht – von der Datensammlung bis zur Sinnstiftung. Sie erinnert uns daran, dass Deutungen nicht einfach „gefunden“, sondern gemacht werden – im Spannungsfeld von Methode, Kultur und Menschlichkeit.
So verstanden ist die Deutungs-Matrix nicht nur ein Analysewerkzeug, sondern auch ein ethischer Kompass: Sie fordert uns auf, zu erkennen, warum wir deuten – und welchen Sinn wir darin suchen.
—
[1] Wie etwa ganz praktisch im Themenfeld der Agrargeschichte: die Funktion der uralten „Brenn-Kultur“ und ihrer neuzeitlichen Implemetierung im eigenen Kreislauf-Selbstversorgergarten oder die Wiederentdeckung des archaischen Lauchgemüses.