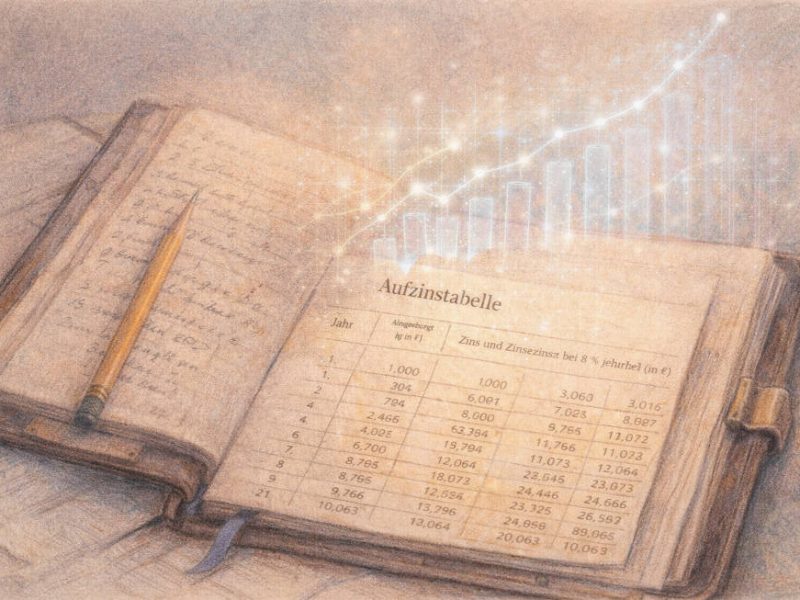Bild: IPGarten GmbH, 2017 – Beispiel einer „Erntekiste“
➡️ Mit dem Studium alternativer Gartenbau-Projekte und ihrer Strukturen hat es eine Weile gedauert, bis ich auf das IPGarten-Projekt gestoßen bin. Da es heute nicht mehr existiert, möchte ich es zumindest in Erinnerung behalten.
Das IPGarten-Projekt war zwischen 2015 und 2019 ein vermeintlich innovatives Vorhaben mit großer medialer Aufmerksamhkeit, das im Rahmen des Bundesmodellvorhabens Land(auf)Schwung im Landkreis Stendal (Sachsen-Anhalt) gefördert wurde. Es ermöglichte Stadtbewohnern, über eine Webplattform Gemüseparzellen auf einem Bio-Acker in Warnau, später auch in Lindenberg, zu pachten und quasi vom heimischen PC aus „fernzusteuern“. Die praktische Arbeit vor Ort übernahmen Gärtner, unterstützt durch Kameras, Sensoren und ein automatisiertes Bewässerungssystem.
Trotz des letztlichen Scheiterns – vermutlich, weil das Projekt in keiner Weise marktwirtschaftlich tragfähig strukturiert war – ist es doch in einem Punkt bemerkenswert: Es machte deutlich, wie groß das Bedürfnis vieler Menschen ist, sich wieder mit der Herkunft ihrer Lebensmittel zu beschäftigen. Das ist der positive Aspekt der Geschichte.

Hier sind die wichtigsten Informationen zum IPGarten, die ich bei einer kurzen Recherche zusammentragen konnte:
Überblick über das IPGarten-Projekt
Konzept
➡️ IPGarten (Internetprotokoll-Garten) ermöglichte es Stadtbewohnern, vor allem aus Berlin, über das Internet einen eigenen Gemüsegarten auf dem Land zu bewirtschaften. Kunden konnten via Webplattform kleine Parzellen (ca. 16 m²) pachten, Pflanzen auswählen und Pflegeanweisungen geben (z. B. Bewässern, Jäten), die vor Ort von Gärtnern umgesetzt wurden. Die Ernte wurde frisch und unverpackt per Kühlwagen nach Berlin geliefert oder an Abholstellen bereitgestellt.
Ziel und Funktionsweise
➡️ Das vom Landkreis Stendal unterstützte das Projekt im Rahmen von Land(auf)Schwung verband Digitalisierung mit nachhaltiger Landwirtschaft, um die Wertschätzung für regionale Lebensmittelproduktion zu fördern, durchaus die Biodiversität zu unterstützen und neue Absatzmärkte für Kleinbauern zu schaffen. Es richtete sich an Menschen, die die Vorteile des Landlebens genießen wollten, ohne selbst vor Ort zu sein.
Jede Parzelle war mit Kameras ausgestattet, sodass Kunden ihr Beet in Echtzeit überwachen konnten. Bewässerung erfolgte automatisch, während manuelle Arbeiten wie Jäten von lokalen Gärtnern übernommen wurden.
Kunden
➡️ 2018 wurden etwa 150 Parzellen à 16 m² von Berliner Kunden gebucht. Für 2019 gab es bereits 250 Anmeldungen, was auf wachsendes Interesse hinweist. Langfristig war geplant, bis 2020 etwa 2.200 Parzellen zu bewirtschaften, um profitabel zu werden.
Ernte: 30 Prozent der Kunden holten ihre Ernte an Abholstellen in Berlin ab, der Rest ließ sie gegen Aufpreis direkt liefern.
Bildung
Das Projekt wurde auch in Schulen integriert, z. B. an der Platanus-Schule in Berlin, um Kindern den Anbau von Lebensmitteln näherzubringen.
Ziele und Wirkung
Nachhaltigkeit
➡️ IPGarten förderte kleinteilige Landwirtschaft statt Monokulturen, schuf Lebensräume für Insekten und Vögel und sensibilisierte für die Herausforderungen der Landwirtschaft (z. B. Biodiversität, Wertschätzung von Lebensmitteln).
Wirtschaftliche Aspekte
➡️ Es schuf Einkommensmöglichkeiten für Kleinbauern durch Kundenbeiträge und potenziellen Direktverkauf von Produkten wie Eiern oder Obst.
Soziale Wirkung
➡️ Das Projekt weckte Interesse an nachhaltiger Lebensmittelproduktion und erhielt internationale Aufmerksamkeit, z. B. aus Südkorea und der Schweiz. Es betonte die Bedeutung von regionaler Wertschöpfung und stärkte die Verbindung zwischen Stadt und Land.
Finanzierung, Skalierung
➡️ Trotz wachsendem Interesse hatte IPGarten 2019 Schwierigkeiten, ausreichend Investoren zu finden. Von den benötigten 790.000 Euro waren nur 500.000 Euro zugesichert.
Die Umsetzung auf zwei Hektar mit 600 Parzellen war für 2019 geplant, doch die langfristige Profitabilität hing von einer größeren Anzahl an Kunden ab, doch laut einem Bericht wuchs 2019 kein Gemüse in Lindenberg, obwohl die Nachfrage hoch war, was auf finanzielle oder organisatorische Engpässe hinweist.
Fazit
IPGarten sollte nicht nur ein „ferngesteuerter Garten“ sein, sondern die Wertschätzung für kleinbäuerliche Arbeit und nachhaltige Produktion fördern. Es wurde als Pionierprojekt gesehen, das die Welt „ein Stück besser machen“ könnte, indem es Arbeitsplätze für Menschen statt Maschinen schafft und die Biodiversität stärkt. Aber die Realität holt am Ende halt auch solche Projekte ein…
Doch warum nicht aus Fehlern lernen?
Was waren die Ursachen des Scheiterns?
Ohne eine tiefgreifende Wirtschaftsanalyse anzustellen, lässt sich feststellen:
Komplexe Logistik
Die Kombination aus digitaler Überwachung (Kameras, Webplattform), manueller Arbeit, automatisierter Bewässerung und schließlich der Lieferung frischer Ware nach Berlin verursachte hohe Kosten. Die für die Profitabilität notwendige Skalierung auf 2.200 Parzellen wurde nie erreicht. 2018 waren es etwa 150 Parzellen, 2019 dann 250 Anmeldungen – ambitioniert war’s ja.
Kundenpreise
Die Beiträge der Kunden – für Pacht, Bewässerung, Technik und Lieferung – deckten die Kosten nicht ausreichend, insbesondere nicht für die aufwendige Logistik der frischen, unverpackten Ernte.
Nur etwa 30 Prozent der Kunden nutzten die Abholstellen, der Rest ließ sich das Gemüse bequem liefern. Naja … ist es nicht allgemein bekannt, dass man prizipell mit Lieferservice bei uns kein Geld verdienen kann…
Eine Parzelle kostete 395 Euro im Jahresabo, was also etwa 33 Euro pro zzgl. 2 EUR pro Lieferung/Liefergebühr entspricht. Laut der IPGarten-FAQ wurden die Erntekisten wöchentlich persönlich nach Berlin/Potsdam geliefert oder konnten in der Berliner Malzfabrik abgeholt werden – unverpackt, in Pfandkisten.
Verkehrte Welt oder: Ein Real-Wurzelimperium
Meiner Ansicht nach – und das ist jetzt etwas spekulativ – lag der Hauptgrund des Scheiterns jedoch woanders: Der Kunde war hier zu sehr „König“. Die Idee, dass der Kunde – ausgerüstet mit allerlei Überwachungstechnik – Natur, Kultur und vor allem die Arbeitskräfte kontrollieren und anweisen kann, ist schon sehr speziell. Und es ist nicht nur speziell, sondern kostet auch Geld und vermutich auch viel zeitlichen Aufwand in der Kommunikation.
Faktisch kaufte der Kunde nicht nur Gemüse. Nein, er kaufte auch die Option, Pflegepersonal per Klick herumzukommandieren – mit vermeintlicher Kompetenz und digitalem Blick über den Gartenzaun.
Ein Real-Wurzelimperium
Man könnte auch sagen: Das Prokjekt war so eine Art „Real-Wurzelimperium“ – angelehnt an das gleichnamige Browsergame, bei dem man mit der Unterstützung von Gartenzwergen Obst, Gemüse und Blumen anbaut, erntet und handelt. Und ja, die Parallele ist nicht weit hergeholt.
Denn so sarkastisch das auch klingen mag: Genau das sollte es wohl sein – eine Art reales Computerspiel, wie Franziska Gronwald es 2018 in ihrem Blogartikel „Per Smartphone Gemüse anbauen“ beschreibt. Laut ihrer Darstellung stand am Anfang des IPGarten-Projekts tatsächlich das Browsergame FarmVille Pate.
Gut, ok – das unternehmerische Risiko trägt ja bekanntlich der Unternehmer … oder etwa die Land(auf)Schwingenden Gartenzwerge? Aber wie dem auch sei. Besser einen Versuch gemacht, als gar nichts. Mit einigen Korrekturen ist es am Ende doch eine gute Idee.
Quellen
Bildquellen: Beitragsbild und Bild 2) IPGarten GmbH, 2017
Landkreis Stendal, „IP Garten“
Thünen-Institut, Begleitforschung Land(auf)Schwung
P.S. In Andenken an Johann Heinrich von Thünen (1783–1850): Das Thünen’sche Modell der Landnutzung.
- https://web.archive.org/web/20160714015120/ http://ipgarten.de/
- https://web.archive.org/web/20161025062017/ https://ipgarten.de/#das-ist-der-ip-garten
- https://web.archive.org/web/20220128221324/ https://ipgarten.de/#das-ist-der-ip-garten
- https://web.archive.org/web/20171230115852/ https://ipgarten.de/#werde-ipgaertner
Messeauftritt bei IGA/re:publica 2017
BATH, Dominik; morgenpost.de; Wie Berliner per Mausklick säen und ernten können; 19.02.2018
GRONWALD, Franziska;franzidesign.de; Smart Gardening: Mein Jahr mit dem digitalen Gemüsebeet von IP Garten – Per Smartphone Gemüse anbauen; 24.10.18
HOPPE, Karina; volksstimme.de, Hoffnung auf virtuelle Ernte 2020, 28.08.2019
HOLDMANN, Hendrik; stern.de; Wie im Computerspiel Neuer Trend „Online-Gärtnern“: virtuell säen, im echten Leben ernten; 30. August 2018