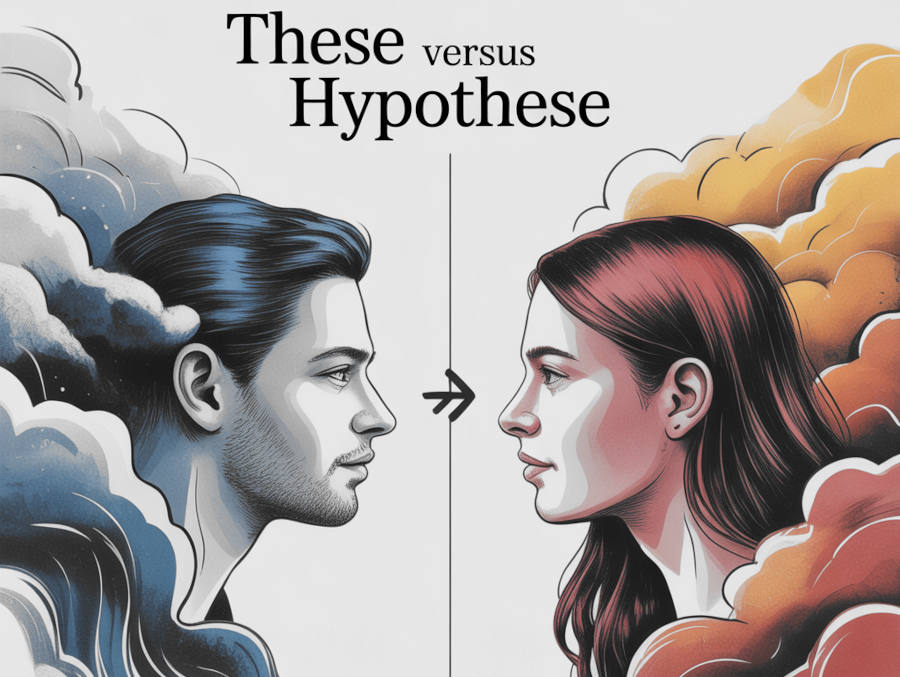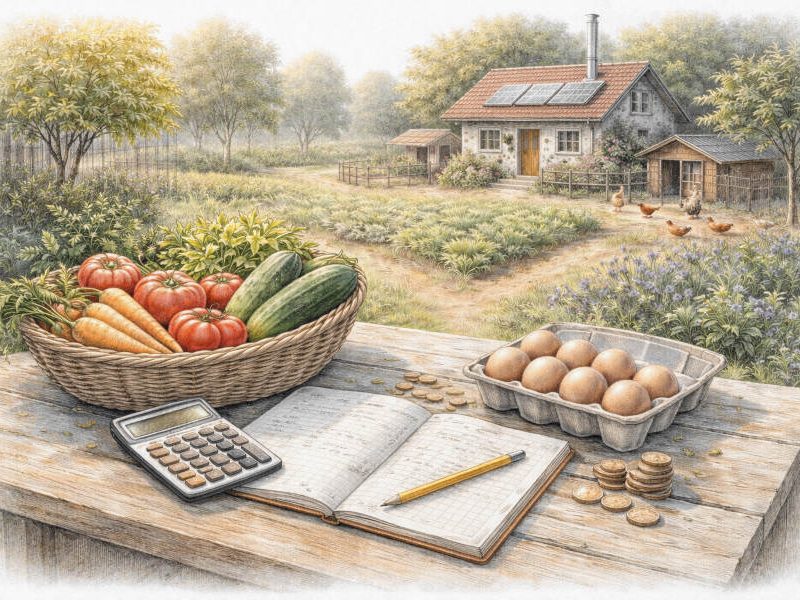Was ist der Unterschied zwischen einer These und einer Hypothese? Und gibt es noch eine dritte Kategorie – die Studie?
❓Irgendwie hatte ich bisher immer das Problem, die Begriffe These und Hypothese durcheinanderzuwerfen. Die Erklärungen, die ich dazu fand, waren meist langatmig, überfrachtet – und damit schwer zu behalten.
Doch offenbar geht es nicht nur mir so. Auch in akademischen Publikationen wird der Unterschied oft unsauber gehandhabt – und in scheinbar wissenschaftlichen, aber propagandistisch gefärbten Texten erst recht. Besonders in Teilen der sogenannten „Klimawissenschaft“ herrscht da ein sprachliches Desaster. Mitunter könnte man meinen, die Verwirrung sei sogar gewollt.
➡️ Um für mich endlich Klarheit zu schaffen, habe ich schließlich die KI befragt – mit der Bitte, mir den Unterschied so einfach zu erklären, dass ihn buchstäblich „auch der Dümmste“ versteht. Und siehe da: Jetzt habe ich es begriffen, und zwar ein für alle Mal. Sinngemäß lautet die KI-Erklärung:
These
🎯 Eine These ist wie eine feste Meinung oder eine Aussage, die du machst und die du beweisen willst. Sie ist wie ein Satz, den du sagst: „Das ist so!“ und dann zeigst du mit Beweisen, dass es stimmt. Eine These kommt oft am Ende, wenn du schon viel weißt und sie mit Fakten untermauern kannst.
Hypothese
🎯 Eine Hypothese ist wie ein erster Gedanke oder eine Vermutung, die du hast, bevor du etwas sicher weißt. Sie ist wie ein „Vielleicht ist das so…“ Du testest sie dann mit Experimenten oder Nachforschungen, um zu sehen, ob sie stimmt oder nicht. Eine Hypothese ist der Anfang, um etwas herauszufinden.
Kurz gesagt
- Hypothese: Ein erster Gedanke, den du testen willst (mit Fragezeichen).
- These: Eine fertige Aussage, die du mit Beweisen untermauert hast (mit Punkt dahinter).
Wie erkennst du den Unterschied?
Schau auf den Kontext: Wird etwas getestet (Hypothese) oder als Ergebnis präsentiert (These)?
Achte auf Formulierungen: „Wir vermuten…“ deutet auf eine Hypothese, „Wir beweisen…“ auf eine These hin.
Jedoch: die Praxis sieht oft anders aus
➡️ Wissenschaftler verwenden die Begriffe manchmal locker. „Hypothese“ wird oft genutzt, wenn sie etwas testen wollen, aber wenn sie schon viel Beweise haben, nennen sie es trotzdem „Hypothese“, obwohl es eher eine These ist. Es hängt vom Kontext ab.
Entwicklungsprozess
➡️ Eine Hypothese kann sich im Laufe einer Studie in eine These verwandeln, wenn die Ergebnisse sie stützen. In der Publikation wird dann manchmal nicht mehr unterschieden, weil der Fokus auf den Ergebnissen liegt.
Ziel einer Publikation
➡️ Manche Arbeiten (z. B. Übersichtsartikel) formulieren Thesen, ohne sie als solche zu kennzeichnen, weil sie als „bewiesen“ gelten sollen. In experimentellen Studien wird eine Hypothese oft klarer angegeben, aber auch da kann es verschwimmen.
Kulturelle Unterschiede
➡️ In verschiedenen wissenschaftlichen Disziplinen (z. B. Naturwissenschaften vs. Geisteswissenschaften) werden die Begriffe unterschiedlich verwendet. In der Physik ist eine „Hypothese“ oft ein Testvorschlag, während in der Archäologie eine „These“ eher eine interpretative Aussage ist.
Und der Sonderfall: Philosophie
🎯 Eine These in der Philosophie ist eine grundlegende, umfassende Behauptung oder eine Lehre. Sie ist nicht mit empirischen Mitteln (Experimente, Daten, achäolog. Artefakte) widerlegbar, sondern wird durch Argumentation und logisches Denken begründet. Sie dient dazu, ein großes, übergeordnetes Bild zu zeichnen und dem Phänomen einen tieferen Sinn zu geben.
Oder anders formuliert: Während ein Naturwissenschaftler eine Hypothese mit Messungen und Experimenten beweist, begründet ein Philosoph seine These mit logischer Kohärenz und überzeugender Argumentation. Es geht nicht darum, die These in der realen Welt zu testen, sondern zu zeigen, dass sie intellektuell schlüssig ist und eine tiefere Wahrheit über ein Konzept (wie die Geschichte, die Existenz oder die Moral) erschließt.
Letzteres ist eine einfache und logische Erklärung. Auf Wikipedia finde ich sie so nicht.
Aber ich bin noch nicht am Ende: es folgt „die Studie“
Nun habe ich zwar den Unterschied zwischen These und Hypothese erläutert, doch scheint es, dass in unserer heutigen Zeit in der Aufmerksamkeit der Menschen noch eine dritte Kategorie danebengetreten ist: die „Studie“. Und das meine ich gar nicht sarkastisch – oder sagen wir: nur ein wenig. Mit den Studien verhält es sich so:
Die These: eine behauptete Aussage, die man prüfen und diskutieren kann.
Die Hypothese: eine vorläufige Annahme, die gezielt überprüft werden soll.
Die Studie: heute oft missverstanden als endgültige Wahrheit – „Es wurde bewiesen, weil eine Studie es sagt!“
Die Studie als Endpunkt. Oder gleich das Abstract?
Ursprünglich war die wissenschaftliche Studie ein Werkzeug, ein Zwischenschritt: Sie prüft Hypothesen, liefert Daten, eröffnet neue Fragen. Im öffentlichen Diskurs hat sie jedoch einen anderen Status bekommen. Eine Studie gilt dort oft als Endpunkt: Wenn eine Studie etwas zeigt, dann scheint die Sache erledigt.
Und es kommt noch besser: Oft genügt den Experten schon die Einleitung, also das Abstract, um sich im Besitz der Wahrheit zu wähnen. [1]
Das Problem dabei, Studien widersprechen sich häufig. Sie sind methodisch begrenzt, sie müssen interpretiert werden, sie können irren. Aber in Schlagzeilen und politischen Debatten erscheint die Studie nicht als Teil eines offenen Prozesses, sondern als Stempel der Wahrheit.
Wissenschaft lebt jedoch vom Prozess. Thesen werden aufgestellt, Hypothesen überprüft, Ergebnisse diskutiert, widerlegt, verbessert. Wo Wissenschaft Zweifel sät, erwartet die Öffentlichkeit Gewissheit. Und genau da entsteht der Bruch.
Vielleicht sollte man sich wieder erinnern: Eine These kann man diskutieren, eine Hypothese prüfen – und eine Studie sollte man kritisch lesen. Denn sie ist kein Schlussstein, sondern nur ein weiterer Baustein im nie fertigen Gebäude des Wissens.
Weitere Bemerkungen
[1] Die ironische Anspielung auf das „Abstract“ bezieht sich auf die sogenannte Cook-Studie (John Cook et al., 2013, Environmental Research Letters). Diese Untersuchung wird oft als Quelle für die Aussage genannt, „97 % der Wissenschaftler seien sich einig, dass der Klimawandel menschengemacht ist“. Methodisch lief es jedoch anders: Untersucht wurden nicht vollständige Arbeiten, sondern rund 12.000 Abstracts (Zusammenfassungen) von Artikeln, die zwischen 1991 und 2011 die Schlagworte global warming oder climate change enthielten. Die Abstracts wurden danach sortiert, ob sie den menschengemachten Klimawandel (anthropogenic global warming, AGW) unterstützten, ablehnten oder neutral blieben. Das Ergebnis: Die allermeisten Abstracts äußerten sich gar nicht zur Ursache des Klimawandels.
Hinzu kommt natülich die infantile Annahme, dass wissenschaftliche Thesen in ihrer Aussagekraft und Glaubwürdikkeit von einer Mehrheitsmeinung abhängig wären.
Aber mal angenommen, so eine Propaganda-Aktion fliegt auf, was würden dann die Akteure tun? Würden sie bei AGW-Akademikern viele neue Studien in Aufrag geben, falls mal eine neue „Metastudie“ in Auftrag gegeben wird? Haben sie das getan?
[1a] sie auch: Deutscher Bundestag Drucksache 19/12228; Kleine Anfrage der Abgeordneten Karsten Hilse, Dr. Heiko Wildberg, Marc Bernhard, Dr. Rainer Kraft, Andreas Bleck und der Fraktion der AfD
Anteil der Wissenschaftler*, die den Klimawandel für menschengemacht erachten. *Die Anfrage war wohl etwas unpräzise, denn niemend definierte genau, was „Klima-Wissenschaftler“ sind.
Thomas Jacob, 8.9.2025, erweitert am 11.9.2025