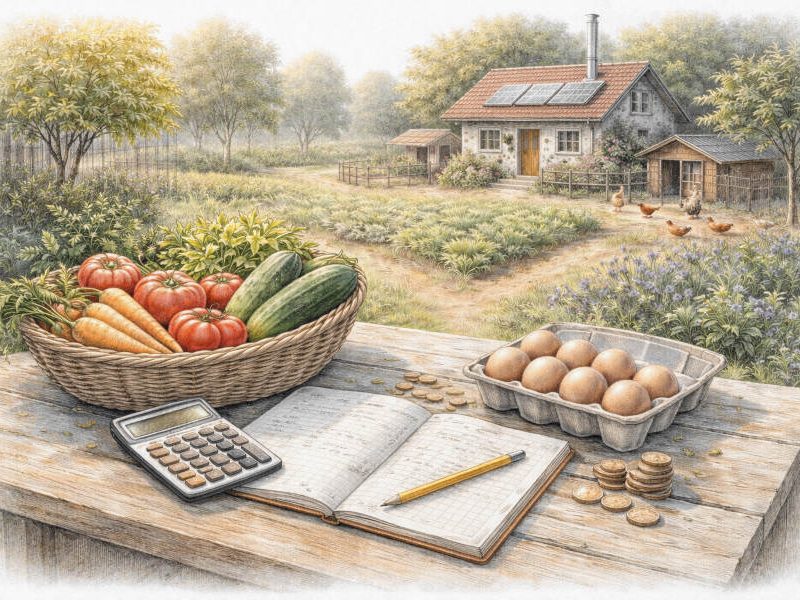Bild: Hausgarten, klassische Gärtnerei, Feldgemüsebau. Jedes Konzept funktioniert nach eigenen Regeln.
➡️ Die folgende Übersicht ist bewusst stichpunktartig gehalten. Sie soll einen klaren Einblick geben, in welchen strukturellen Formen hierzulande – und weltweit – Gemüseanbau betrieben wird.
Die Auseinandersetzung mit diesen unterschiedlichen Strukturen ist weit bedeutsamer, als es auf den ersten Blick scheint. Denn wer sich mit Fachliteratur beschäftigt oder online nach gärtnerischen Ratschlägen sucht, sollte stets im Blick haben, auf welche Form des Anbaus sich ein bestimmter Tipp eigentlich bezieht.
Wird dieser Kontext nicht beachtet, sind Missverständnisse – und damit Misserfolge – vorprogammiert.
Beispiel: Was im Market Gardening hervorragend funktioniert, ist im Kleingarten oft ungeeignet [1]. Und der Landwirt, der Möhren, Lauch oder Rosenkohl im Feldbau kultiviert, wird kaum auf Ratschläge aus dem Schrebergarten zurückgreifen.
➡️ Gerade in dieser Vielfalt wird deutlich: Es braucht präzisere Begriffe und klarere Definitionen für die verschiedenen Formen des Gemüsebaus. Einige Vorschläge dazu finden sich im Folgenden. Sie sollen helfen, systematische Orientierung zu schaffen.

Ziel ist es, jene Irritationen zu vermeiden, die immer wieder auftreten, weil die unterschiedlichen Anbauformen sprachlich unscharf oder unreflektiert gleichgesetzt werden.
Ein Beispiel: Der Begriff Marktgärtnerei wird heute häufig auf kleinstrukturierte Gemüsebaubetriebe angewandt, die nach dem Prinzip des Market Gardenings arbeiten und ihre Produkte über Abokisten oder Hofläden vermarkten.
➡️ Ursprünglich jedoch bezeichnete Marktgärtnerei die klassischen Stadtgärtnereien: Betriebe mit breitem Sortiment, die über lokale Märkte oder den Großhandel vertrieben. Wer diese Unterscheidung nicht kennt, riskiert, versteht sowohl historische als auch heutige Strukturen leicht falsch.
Die Formen des Gemüseanbaus im Überblick
1. Selbstversorgender Gartenbau, Kleingärtner
➡️ Diese Anbauform ist auf den Eigenbedarf einer Familie oder Hausgemeinschaft ausgelegt.
Fläche: meist kleine Gärten (unter 1.000 m²) bis hin zur Balkongärtnerei Es gibt etliche Sonderformen, die unterschieden werden sollten: Küchengarten, Kleingarten, Wochenendgarten, Selbstversorgergarten und den fließenden Übergamg zum Erwerbsgartenbau: Klein-Erwerbs-Gartenbau, Micro Farming
Typische Kulturen: Kleingarten-Sorten von Obst, Gemüse und Kartoffeln
Merkmale: Mischkultur, samenfeste Sorten, oft Handarbeit, Lagergemüse wichtig.
Ziel: Ergänzung des Marktangebotes, Frische aus dem eigenen Garten, Ernährungssicherheit, Unabhängigkeit,
2. Stadtnahe Vollsortimentsgärtnerei (klassische Stadtgärtnerei)
➡️ Eine alte Form des Gartenbaus: Gärtnereien, oft mit Gewächshaus, die ganzjährig Jungpflanzen Gemüse und Blumen produzieren, daneben auch Floristik und Handelsware
Fläche: 0,5 bis 2 Hektar.
Typische Kulturen: Gemüse, Kräuter, Blumen – je nach Jahreszeit. Selten Obst.
Merkmale: hohe Vielfalt, eigene Jungpflanzenzucht, Anlieferung an Märkte, Küchen oder Floristen.
Ziel: Versorgung der Stadtbevölkerung aus nächster Nähe.
3. Market Gardening, Direktvermarktung
➡️ Hier wird für Wochenmärkte, Hofläden oder Gemüsekisten produziert – auf kleinem Raum, aber professionell.
Fläche: meist 1.000 bis 10.000 m².
Typische Kulturen: Feingemüse wie Salate, Radieschen, Mangold, Kräuter.
Merkmale: Es wird saisonal Pflanzgemüse angebaut, intensive Bodennutzung, meist Handarbeit. Zugekaufte Jungpflanzen werden verpflanzt. Trotz Vielfalt eine Ergänzung der Händlerangebote.
Ziel: Frische für lokale Kunden, kurze Wege, hohe Produktqualität.

3.1. Solidarische Landwirtschaft (Solawi)
➡️ Hier produziert ein Betrieb für eine feste Gruppe von Menschen, die ihn finanziell tragen.
Fläche: oft 1 bis 3 Hektar.
Typische Kulturen: saisonal gemischtes Gemüseangebot, ggf. mit Eiern, Obst, Brot ergänzt.
Merkmale: wöchentliche Verteilung, Mitgliederarbeit, transparente Anbauweise.
Ziel: gemeinschaftlich getragene Versorgung, Unabhängigkeit vom Markt.

3.2. Gartenbau kombiniert mit Freizeit, Pädagogik und Eventkultur (Begriff?)
➡️ In dieser Sonderform wird Gemüsebau nicht primär als landwirtschaftliche Produktion verstanden, sondern als Teil eines Erlebnis-, Bildungs- oder Freizeitangebots. Schaugärten, Selbsterntefelder, Hofcafés, Kürbisausstellungen oder Gartenerlebnisparks sind typische Beispiele.
Die landwirtschaftliche Fläche dient hier zugleich als Kulisse für Veranstaltungen, Familienausflüge, saisonale Märkte oder pädagogische Programme. Der Gemüsebau wird damit in ein touristisch-kommerzielles Gesamtkonzept eingebettet, das stark auf Besucherorientierung, Atmosphäre und Zusatzangebote setzt.
4. Großmarkt-Gemüsebau, Großhandelsorientierter Anbau
➡️ Dieser Anbau versorgt Supermärkte oder Zwischenhändler mit standardisierter Ware.
Fläche: oft mehrere Hektar.
Typische Kulturen: Salat, Kohl, Tomaten, Zucchini, Gurken.
Merkmale: Sorten mit guter Lager- und Transportfähigkeit, Erntemaschinen, Folienabdeckung.
Ziel: Mengenproduktion für den überregionalen Markt.

4.1. Industrieller Feldgemüsebau, Feldgemüsebau (industriell-mechanisiert)
➡️ Das ist der große, spezialisierte Gemüseanbau – für Industrie oder Lebensmitteleinzelhandel.
Fläche: mehrere bis viele Hektar.
Typische Kulturen: Möhren, Zwiebeln, Porree, Sellerie, Knoblauch.
Merkmale: maschinelle Aussaat und Ernte, industrielle Abnahme, hohe Investitionen.
Ziel: hohe Flächenleistung, Versorgung großer Abnehmer, günstiger Preis.
6. Parzellenmarktbau, eine Sonderform, die z. B. in Südchina anzutreffen ist
➡️ Eine Kultur, eine Fläche, ein Markt – kleinbäuerlich, aber effizient.
Fläche: oft nur 2.000 bis 10.000 m².
Typische Kulturen: Monokultur: z. B. Lauch, Spinat, Kohl, Melonen.
Merkmale: kulturspezifisches Know-how, weitgehend manueller Anbau und Ernte, eigene temporäre Marktstände.
Ziel: Direktverkauf am städtischen Markt (auch Küchen, größere Abnehmer usw.) Versorgung mit einem Ernteprodukt.
—
Bilder: 2) Bluerasberry, 2023; 3) IPGarten GmbH; 4) Dirk Ingo Franke, 2015; 5) Miyuki Meinaka, 2021
2) https://commons.wikimedia.org/wiki/ File:Tlacolula_Market_230122_62.jpg
3) https://de.wikipedia.org/wiki/Datei:IPGarten_Gem%C3%BCsekiste_Erntekiste.png
4) https://commons.wikimedia.org/wiki/ File:Schwanteland_Gem%C3%BCse_zum_Selberernten _25.05.2015_14-26-54.JPG
5) https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nissato_Green_Onion_2.jpg
[1] Ein gutes Beispiel ist die Bodenbearbeitung: Im professionellen Gemüsebau wird oft das No-Dig-Verfahren angewendet, bei dem der Boden nicht umgegraben, sondern nur tiefgründig mit einer speziellen Grabegabel (Breitgabel, Doppelgrabegabel, Broadfork, Grelinette) gelockert wird. Jährlich wird eine dicke Schicht Kompost aufgetragen – das spart Zeit und erhält die Bodenstruktur. Allerdings setzt diese Methode regelmäßige Anlieferungen großer Mengen Komposterde voraus.
Im Kleingarten, wo meist nur 100–200 m² bewirtschaftet werden, ist das kaum praktikabel. Hier hat sich eine Kombination aus oberflächlichem Umgraben und tiefer Lockerung – also die klassische Tiefbeetkultur – als ressourcenschonendere und langfristig effektivere Lösung bewährt.
- JACOB, T.; derkleinegarten.de; Biointensiver Gartenbau nach John Jeavons – GROW BIOINTENSIVE®; 29.1.2021
- JACOB, T.; derkleinegarten.de; Tiefbeetkultur und Intensivgemüsebau im Kleingarten – Einleitung, Anbautechnik
- JACOB, T.; derkleinegarten.de; No-dig-gardening – Gärtnern ohne Umzugraben – ökologischer Gemüsebau?; 17.10.2020
[2] Das IPGarten-Projekt war ein gefördertes Vorhaben im Rahmen des Bundesmodellvorhabens Land(auf)Schwung im Landkreis Stendal (2015–2019). Es ermöglichte Stadtbewohnern, über eine Webplattform Gemüseparzellen auf einem Bio-Acker in Warnau und später Lindenberg (Sachsen-Anhalt) zu pachten und vom Sofa aus „fernzusteuern“, während Gärtner vor Ort die Pflege übernahmen.