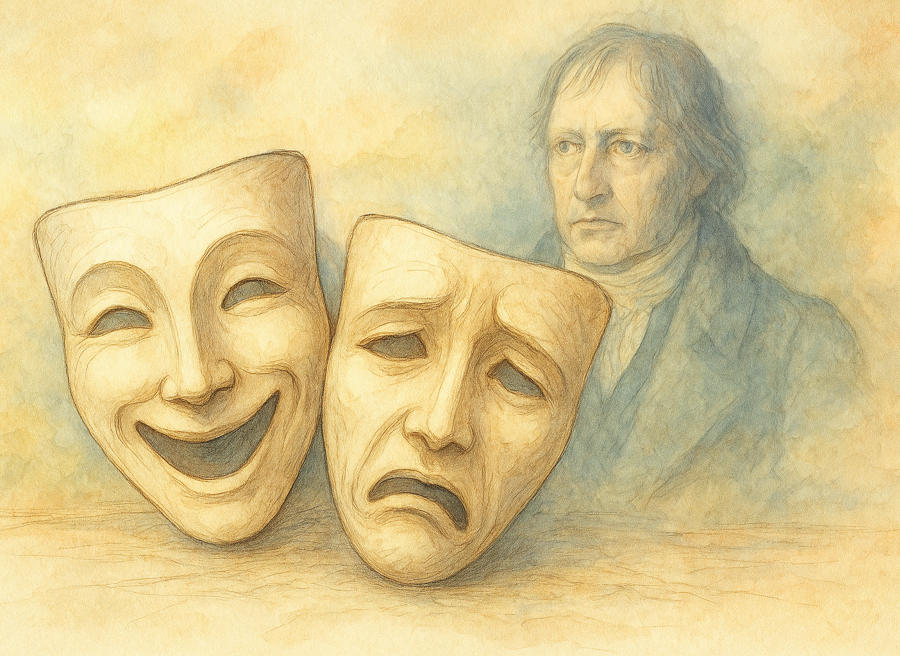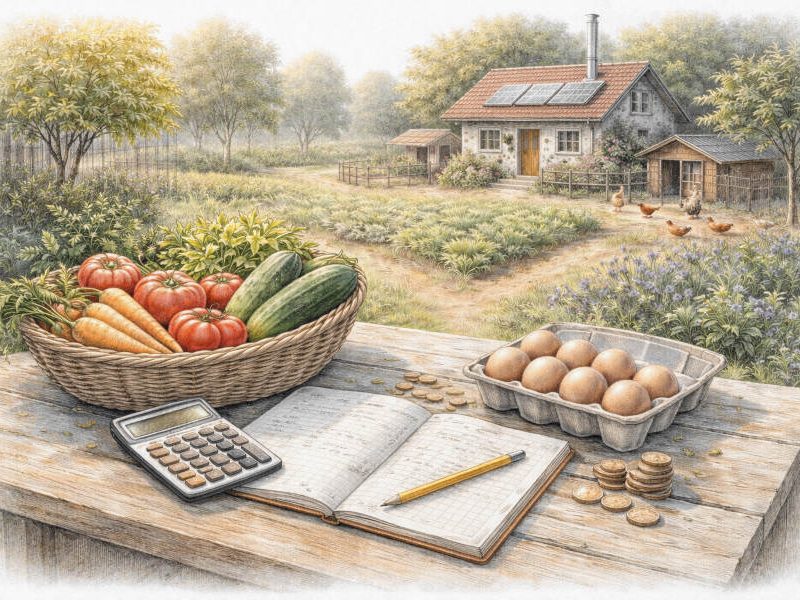Bild: Hegels Philosophie von der „Listigkeit der Vernunft“ deutet auf ein Theaterstück der Weltbühne. Die Akteure und Darsteller (Luther, Napoleon, Politikerinnen, wer auch immer) spielen ihre persönlichen Rollen, glauben, es gehe nur um sie – doch im Hintergrund führt die „List der Vernunft“ Regie. [2]
➡️ Da ich hier auf dem Inhortas-Blog zunehmend auch geschichtliche Themen vorstelle – darunter eigene Thesen, Hypothesen und Quellenstudien, vor allem aus der geschichtsphilosophischen Perspektive von Agrar- und Zivilisationsgeschichte [1] – komme ich nicht umhin, ein paar grundlegende Beobachtungen zu Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770–1831) festzuhalten. Anlass ist nicht zuletzt, dass ich hier bereits einen kurzen, unterhaltsamen Aufsatz über die zyklische Deutung der Menschheitsgeschichte veröffentlicht habe.
Darin erwähnte ich Oswald Spengler (1880–1936), dessen Ideenwelt ich demnächst gern noch weiter beschreiben und in die Gegenwart übersetzen möchte. Spenglers These vom zyklischen Auf- und Niedergang der Zivilisationen (und das ist der Kern einer Idee) lässt sich jedoch nur dann wirklich verstehen, wenn man sein Verhältnis zu Hegel und dessen Schule kennt – und damit auch die geschichtsphilosophischen Grundgedanken Hegels selbst.
Im Sinne einer nützlichen Allgemeinbildung skizziere ich hier also knapp Hegels Geschichtsphilosophie, die im Ansatz bereits einem linear-zyklischen Modell ähnelt. Originell freilich erscheint sie mir nicht – dazu unten mehr.
Hegels Geschichtsphilosophie in Kürze
Hegel entwirft ein Geschichtsbild, das von verborgenen Gesetzmäßigkeiten getragen ist. Sie geben der scheinbar chaotischen Abfolge von Ereignissen Richtung und Sinn.
Die zentralen Prinzipien sind:
1. Die Entfaltung des Weltgeistes.
Der „Weltgeist“ ist kein mystisches Wesen, sondern schlicht die Vernunft. Geschichte bedeutet für Hegel den Weg der Menschheit zu immer größeren rationalem Bewusstsein und wachsender Freiheit. Anfangs war Freiheit nur ein Privileg weniger (Adel, Priester), mit der Zeit aber dehnt sie sich auf ganze Völker aus. Kunst, Religion und Philosophie sind Ausdruck dieser Entwicklung.
2. Die List der Vernunft.
Menschen handeln aus Eigeninteresse – Macht, Ruhm, Reichtum, religiöser Eifer. Doch am Ende dienen ihre Taten unbewusst einem höheren Zweck: dem Fortschritt der Vernunft. Napoleon etwa wollte Ruhm und Herrschaft, verbreitete dabei aber Rechtsgleichheit und moderne Institutionen. Luther wollte kirchliche Missstände anklagen, eröffnete jedoch zugleich neue Räume für Individualität und geistige Freiheit. (siehe auch [2])
3. Die Dialektik.
Das eigentliche Bewegungsprinzip der Geschichte ist für Hegel die Dialektik: These – Antithese – Synthese. Ein Widerspruch bricht auf, er eskaliert, und aus der Spannung entsteht eine neue, höhere Ordnung. (s.[3])
Beispiel für Dialektik: die Französische Revolution
Hegel illustriert seine Dialektik gern an der Französischen Revolution:
1️⃣ These (Ancien Régime): Absolutismus, Ständeordnung, Willkürherrschaft – eine Ordnung im Widerspruch zur Vernunft.
2️⃣ Antithese (Revolution und Terror): Der Aufstand entfesselt das Ideal absoluter Freiheit. Ohne stabile Institutionen kippt diese Freiheit jedoch in Terror und Gewalt.
3️⃣ Synthese (Napoleonischer Staat): Aus dem Chaos erwächst eine neue Ordnung. Napoleon bewahrt die Errungenschaften der Revolution (Rechtsgleichheit, Ende der Feudalherrschaft), stabilisiert sie aber in einem funktionierenden Staatswesen mit dem Code civil.
Für Hegel ist die Revolution somit kein Zufall, sondern ein notwendiger Schritt auf dem Weg zur Verwirklichung der Freiheit.
Ich sehe darin freilich weniger eine tiefe Geschichtsanalyse als vielmehr eine philosophische Spiegelung seines eigenen Zeiterlebens, also der napoleonischen Epoche.
Mein kritischer Kommentar…
… sei hier nur kurz angerissen: Wie eingangs angedeutet, halte ich Hegels Philosophie nicht für besonders originell. Sie greift auf antike Vordenker wie Platon zurück und formuliert im Grunde nur akademische Binsenweisheiten – allerdings in kunstvoll verklausulierter Sprache. Mit Begriffen wie Weltgeist, List der Vernunft [2] und Dialektik [3] hüllt er Selbstverständlichkeiten in einen philosophischen Nebel.
Das Resultat ist eine scheinbar tiefgründige Geschichtsphilosophie, die jeder sofort versteht, weil er sie ohnehin immer schon ahnte. Hegels Anhängerschaft hatte nun den Vorteil, mit diesen Termini den Intellektuellen zu spielen, ohne unbedingt tiefere Bildung mitzubringen.
Meine Hypothese ist – und das ist eine andere Geschiche – dass Oswald Spengler genau dieses akademische Nachgeplappere seiner Zeitgenossen verachtete – samt dem pseudowissenschaftlichen Gehabe der Marxisten und anderer linker Ideologen, zu denen man durchaus auch die nationalen Sozialisten zählen darf.
Weitere Hinweise
[1] „Zivilisation“ ist Teil der Agrargeschichte, zumindest im Sinne der Wortherkuft. Es gab in der Zeit der antiken Römer Siedlungen (korrekter: Verwaltungseinheit), die als „civitas“ bezeichnet wurden und immer auch ein bäuerliches Umfeld einschlossen.
[2] Schon die Bibel kennt die Idee der „List der Vernunft“: „Ihr habt Böses gegen mich geplant; aber Gott hat es zum Guten gewendet …“ (1. Mose 50,20).
Man mag sich fragen, ob Hegels „List der Vernunft“ wirklich so einleuchtend ist, wie er es selbst suggeriert. Dass große Akteure der Geschichte – ob Luther, Napoleon oder sonstige „Weltgeister“ – letztlich nicht nur sich selbst, sondern einem höheren Ziel dienen, klingt im ersten Moment plausibel. Doch was ist das eigentlich für eine Instanz, die hier „Regie führt“? Hegel nennt sie die Vernunft, den „Weltgeist“. Damit ist kein Unterbewusstsein gemeint (wie es Freud später ausformulierte) und auch keine ökonomische Eigendynamik (wie Adam Smith sie in seiner „invisible hand“ beschrieb). Bei Hegel ist es ein metaphysisches Prinzip, eine Art unsichtbare Logik der Weltgeschichte, die unausweichlich auf Freiheit und Selbstbewusstsein hinausläuft.
Gerade hier zeigt sich eine Schwäche seines Ansatzes: Während Smiths Marktlogik wenigstens im Kleinen empirisch beobachtbar bleibt – dass also die Gier des Kaufmanns unter Umständen den Wohlstand aller mehrt – bleibt Hegels Weltgeist eine Behauptung im luftigen Überbau. Er kann nicht belegt werden, sondern wird vorausgesetzt. Das macht ihn für den nüchternen Beobachter schwerer zugänglich: Ist es wirklich „die Vernunft“, die hier listig lenkt, oder nicht eher das Wirken unbewusster Kräfte, ökonomischer Notwendigkeiten oder schlicht Zufälle, die im Nachhinein mit Sinn überzogen werden? Genau an dieser Sollbruchstelle klafft die Hegelsche Geschichtsphilosophie auseinander – zwischen einem faszinierenden Deutungsrahmen und einer kaum haltbaren metaphysischen Setzung.
[3] Das Wort Dialektik stammt aus dem Griechischen (dialektikē = Kunst des Gesprächs) und wurde im besonderen Maße durch Platon geprägt.