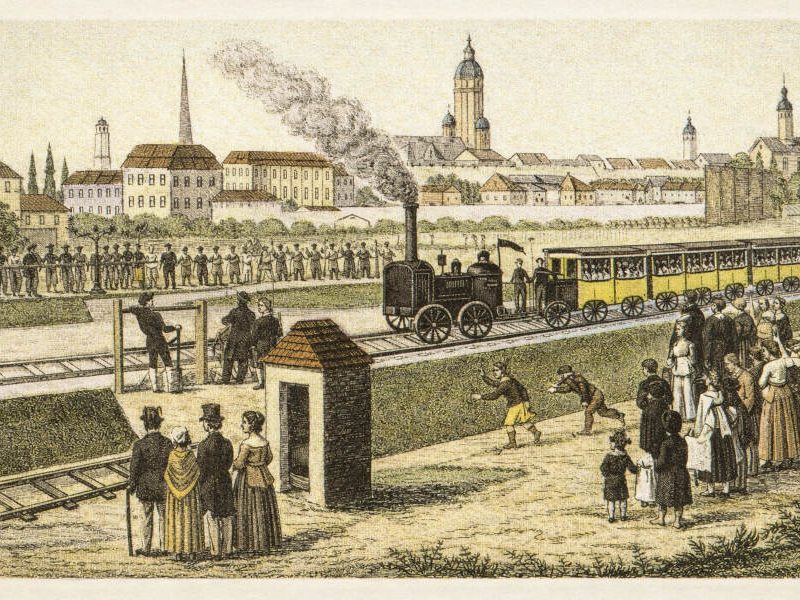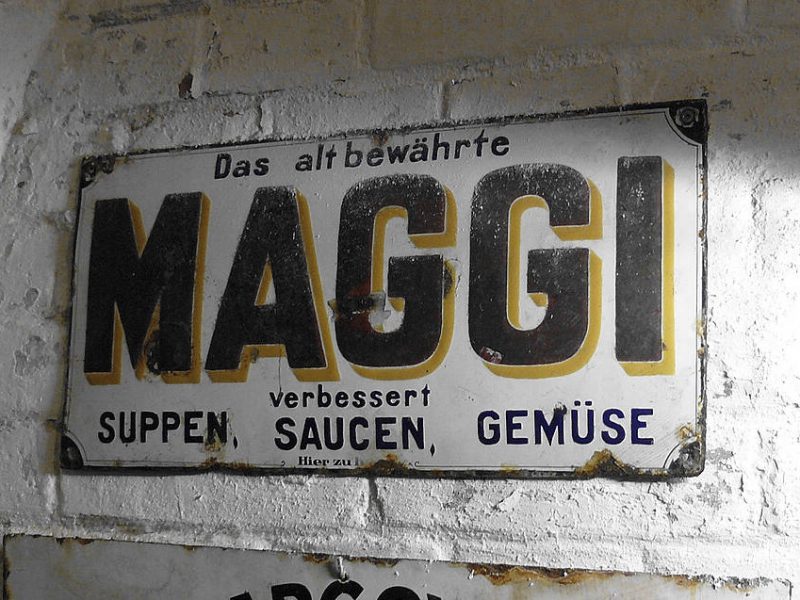Rentierzeit – Definition. Ein überkommender archäologischer Begriff. Heute: „Magdalénien“ … doch vielleicht noch unbekannter.
[Die Nacheiszeit] [Mesolithikum]
Ein fast vergessener archäologischer Fachbegriff, der heute kaum noch verwendet wird, wirft bei genauerem Hinsehen ein überraschend vielschichtiges Licht auf das Denken einer vergangenen Wissenschaftsepoche – und vielleicht auch auf Funde, deren Deutung heute ins Rätselhafte entrückt ist.
Ich greife ihn hier nicht ohne Grund auf. In einem späteren Beitrag möchte ich näher auf eine bemerkenswerte Beobachtung des Heidelberger Altgermanisten Prof. Dr. Johannes Hoops (1865–1949) eingehen.
In seinem monumentalen Werk „Waldbäume und Kulturpflanzen im germanischen Altertum“ [1] erwähnt er kunstvoll geschnitzte Gerstenähren – gefertigt aus Rentiergeweih. Diese stammen aus der Höhle von Espélugues bei Lourdes in den Pyrenäen [2].
Eine Entdeckung, die seinerzeit für Aufmerksamkeit sorgte, deren Tragweite heute jedoch kaum mehr gewürdigt wird. Vielleicht, weil der kulturelle Rahmen, in dem solche Funde einst interpretiert wurden, längst aus dem allgemeinen Bewusstsein verschwunden ist.

Was also war die „Rentierzeit“?
Um 1900 verstand man darunter eine Phase der europäischen Urgeschichte, die man heute grob der späten Altsteinzeit (dem Jungpaläolithikum) und dem Übergang zur Mittelsteinzeit (Mesolithikum) zuordnet.
Der Begriff wurde vor allem von skandinavischen Archäologen wie Sophus Müller geprägt und bezog sich auf eine Epoche, in der das Rentier für die prähistorischen Jägergemeinschaften eine zentrale Rolle spielte – als Nahrungsquelle, als Lieferant für Geweih, Knochen und Felle, als Objekt der Jagd und letztlich als zivilisatorischer Orientierungspunkt.

Das Magdalénien (ca. 17.000–12.000 v. Chr.)
Allerdings war der Begriff „Rentierzeit“ nie exakt definiert. Mit dem wissenschaftlichen Fortschritt wurde er durch differenziertere kulturelle Einordnungen ersetzt – etwa durch das Magdalénien (ca. 17.000–12.000 v. Chr.) [4] oder das Azilien (ca. 12.000–9.000 v. Chr.), die archäologisch schärfer gefasste Einheiten bilden.
Um 1900 hingegen diente die „Rentierzeit“ eher als übergreifendes Etikett, das den tiefgreifenden Einfluss des Rentiers auf die Lebensweise prähistorischer Gruppen in einer bestimmten klimatischen Übergangszeit zu fassen versuchte.
Vielleicht ist es gerade dieser übergreifende, beinahe symbolische Charakter, der den Begriff heute wieder interessant macht – nicht als exakte wissenschaftliche Kategorie, sondern als Denkfigur, die es erlaubt, scheinbar rätselhaften Artefakten wie den geschnitzten Gerstenähren aus der Espélugues-Grotte nachzuspüren. Denn womöglich erzählen solche Funde mehr über kulturelle Übergänge, symbolische Welten und frühe Vorstellungen von Ackerbau, als man ihnen heute zutrauen würde.

Die Rentierzeit, zentralens Thema der prähistorischen Forschung bis Mitte des 20. Jahrhunderts
Spätestens mit den entdeckten Malereien in der Höhle von Altamira (Kantabrien, Spanien, 1868 entdeckt) erkannte man, dass die Rentierkultur eine der letzten großen aber auch hoch entwickleten Kulturformen der Altsteinzeit (Jungpaläolithikum) in Westeuropa darstellte.
Diese spät-mittelsteinzeitlich Kultur, in der es noch keine polierten Steinäxte gab, wurde rasch zu einem zentralen Thema der prähistorischen Forschung – eine Entwicklung, die durch spektakuläre Funde wie die Höhlenmalereien von Lascaux in den folgenden Jahrzehnten noch erheblich an Dynamik gewann.
Johannes Hoops und zahlreiche Forscher nach ihm [5] vermuteten, dass sich aus dieser kulturellen Blütezeit im westlichen Europa allmählich die Grundlagen des Ackerbaus herausbildeten. Hatte er recht?
—
Quellen und Hinweise
Beitragbild ganz oben: ©Grand-Duc, 2005; https://commons. wikimedia.org/wiki/ File:Reindeer_in_finnish_fell.JPG
[1] HOOPS, Johannes: Waldbäume und Kulturpflanzen im germanischen Altertum, Straßburg 1905.
Bild 2) von Seite 278, Bildkopie im Buch von Edoueard Piette aus „Études d’Ethnographie Préhistorique – Les plantes cultivées de la période de transition au Mas-d’Azil.“ 1896
[2] Die Grotte von Espélugues ist eine prähistorische Höhle in Lourdes, die auf dem Colline du Calvaire (Kalvarienberg) liegt. Sie ist bedeutend für ihre archäologischen Funde, die Aufschluss über das Leben unserer Vorfahren in der Oberpaläolithischen Epoche (insbesondere der Magdalénien-Kultur) geben. Hier wurden Artefakte gefunden, darunter das berühmte „Cheval de Lourdes“ (Lourdes-Pferd), eine prähistorische Pferdedarstellung.
[3] https://fr.wikipedia.org/wiki/Grotte_des_Esp%C3%A9lugues; Alain Morala Collection, Zimmer 05 (National Antiquities Museum), Nr. MPHC 51.; Bildunterschrift auf wikipedia: „Pflanze (?) Knochen geschnitzt.“
Bilder 3) ud 4): Ausstellungsstücke im Musée des Antiquités Nationales, Saint-Germain en Laye, Frankreich; ©Guérin Nicolas, 2011
[4] Benannt wurde das Magdalénien im Jahre 1869 von Gabriel de Mortillet nach der Höhlen-Grotte La Madeleine im Département Dordogne.
- https://fr.wikipedia.org/wiki/Magdal%C3%A9nien
- https://de.wikipedia.org/wiki/Magdal%C3%A9nien
[5] Zum Beispiel hier auf inhortas vorgestellt: Prof. Dr. Emil Werth (1869–1958).
Literatur: WERTH, Prof. Dr. Emil; Grabstock Hacke und Pflug; Ludwigsburg 1954.
Werth geht davon aus, dass die Landwirtschaft in Europa aus der Campignien-Kultur hervorging (von Werth auf 7000 bis 5000 v.Chr. datiert). Um 1950 sah die Archäologie die Campignien-Kultur teilweise in engerer Verbindung zur Magdalénien-Kultur (ca. 17.000–12.000 v. Chr.), allerdings nicht als direkte Nachfolgerin, sondern eher als Teil einer mesolithischen Entwicklung, die auf paläolithische Traditionen wie die des Magdalénien zurückzuführen sein könnte. Diese Sichtweise war von den damaligen methodischen und theoretischen Rahmenbedingungen geprägt.
In den 1950er-Jahren war die Archäologie stark auf typologische Vergleiche von Werkzeugen fokussiert. Die makrolithischen Werkzeuge der Campignien-Kultur (z. B. grobe Kernbeile, Tranchets) wurden manchmal mit den robusten Steinwerkzeugen des späten Magdalénien verglichen, da beide Kulturen in ähnlichen Regionen (Nordwesteuropa, insbesondere Frankreich) vorkamen. Dies führte zu der Annahme, dass die Campignien-Kultur eine Art „Weiterentwicklung“ oder regionale Anpassung paläolithischer Traditionen darstellen könnte.