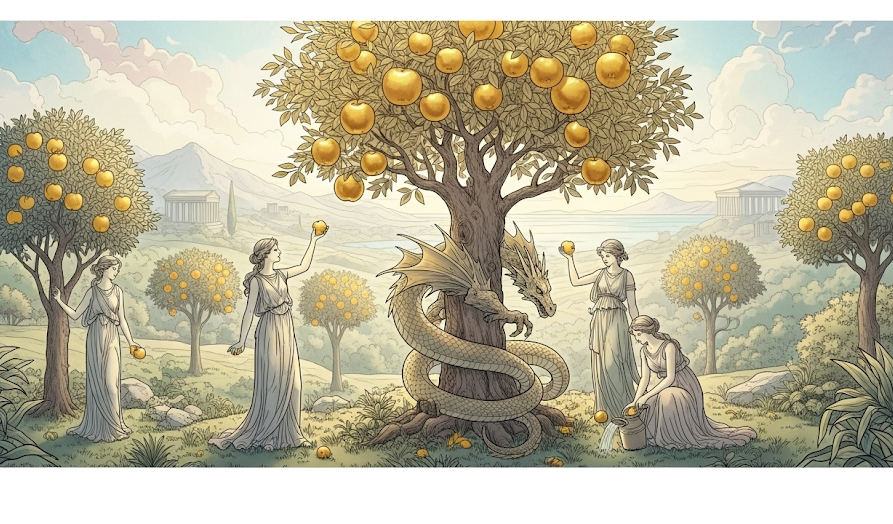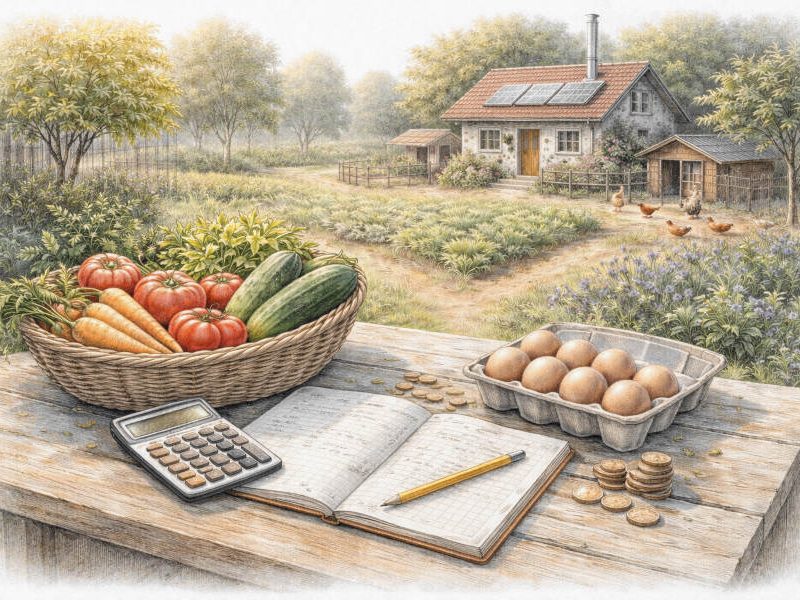Bild: In der griechischen Mythologie war der Garten der Hesperiden ein paradiesischer Ort, der am westlichen Rand der Welt, oft in der Nähe des Atlasgebirges oder auf einer fernen Insel, lokalisiert wurde.
Dieser Garten gehörte den Hesperiden, den Nymphen des Abendrots, und war berühmt für seine goldenen Äpfel, die Unsterblichkeit verliehen. Ein Thema, welches man philosophisch betrachten könnte…
Prähistorische Philosophie. Eine These und Definition
Zur Annäherung an den Begriff des Mythos greife ich zunächst auf eine lexikale Erklärung aus dem Lexikon früher Kulturen [1]zurück:
«Mythos [griechisch: Wort, Erzählung] – Erzählung von Göttern, Geistern, von Welt- und Menschenentstehung der Urzeit, vom Weltende und vom Ursprung der Kultriten. Der Mythos gehört zur ältesten Literatur… »
… obgleich er in der Regel aus der schriftlosen Kulturzeit stammt.
Das Lexikon weist zudem ausdrücklich darauf hin, dass Mythen in den frühen Gesellschaften entstanden, um ethnische Traditionen zu erklären und zu festigen. Mit anderen Worten: Sie dienten einem Zweck.
Dieser Gedanke ist nicht trivial. Denn zweckgebundene Erzählungen haben größere Überlebenschancen. Sie werden tradiert, weil sie etwas leisten – Orientierung, Sinnstiftung, Gemeinschaft. Und was sich über Zeiten erhält, trägt offenbar Gewicht.
Von hier aus lässt sich meine These formulieren: Das, was wir heute der Philosophie zuschreiben, finden wir in den Mythen bereits vorgeformt als eine Ur-Philosophie von Gewicht, deren Bestand ihre Gültigkeit bezeugt.
Mythos als verdichtete Philosophie. Beispiele.
Ein Mythos ist mehr als eine bloße Erzählung. Er ist ein in die Zeitlosigkeit transformierter philosophischer Gedanke – eine Form prähistorischer Philosophie.
Im Unterschied zu abstrakten Abhandlungen, die oft eng an den Horizont ihrer Epoche gebunden bleiben, verdichtet der Mythos komplexe Ideen in symbolischen Bildern und Handlungen, die über Generationen hinweg verständlich bleiben.
So verwandelt Hesiods Theogonie [2] kosmologische Fragen nach Ursprung und Ordnung in eine Göttergenealogie; der Ödipus-Mythos [3] gießt ethische Dilemmata wie Schicksal und Verantwortung in eine dramatische Handlung.

Und in der Bibel [4] finden wir den Mythos vom gepflanzten Paradiesgarten, der einen heilen Urzustand des Menschen beschreibt. Durch die Verbannung aus diesem Garten wird der Mensch zum Ackerbauern und Hirtennomaden, was wiederum die Ursache für Mord und Gewalt darstellt.“
Die Effizienz des Symbols
Diese Transformation gelingt, weil Mythen Effizienz und Emotionalität verbinden. Sie sprechen das kollektive Gedächtnis an, indem sie universelle Themen – Leben, Tod, Gerechtigkeit – in zugängliche, erinnerbare Geschichten überführen.
Platon selbst griff auf Mythen zurück, etwa in der Atlantis-Erzählung, um philosophische Konzepte zu illustrieren. Er wusste: Der Mythos vermag, was die bloße Argumentation oft nicht erreicht – er macht Abstraktion anschaulich, er bindet Denken an Imagination.
So wird der Mythos zum Träger philosophischer Reflexion, der seine Essenz von der Zeit ablöst und in einer Art ewiger Gegenwart bewahrt. Er ist Spiegel der menschlichen Suche nach Sinn, unabhängig von Epoche und Medium.
Religiöse Mythen als Religionsphilosophie
Die religiösen Mythen – Hesiods Kosmogonie, die Schöpfungsgeschichten der Bibel oder die Erzählungen von Odin – lassen sich als frühe Religionsphilosophie deuten. Sie bieten Antworten auf die großen Fragen: Woher kommt die Welt? Wozu lebt der Mensch? Was bedeutet Transzendenz?
Noch bevor systematische Theologie entstand, verbanden Mythen spirituelle Erfahrung mit spekulativem Denken. Sie schufen eine Brücke zwischen Religion und Philosophie, tief verankert in der kollektiven Identität.
Kunstform und Freiheit
Wenn Mythen aber philosophische Gedanken transportieren, dann sind sie auch eine Form von philosophischer Kunst. Und wie jede Kunst darf auch diese Form von einer gewissen Freiheit profitieren – von der Freiheit, nicht streng logisch oder systematisch sein zu müssen, sondern im Bildhaften, im Poetischen, im Symbolischen Wahrheit zu entfalten.
So erscheinen Mythen als eine prähistorische Philosophie eigener Art: eine Denkform, die nicht nur erklärt, sondern zugleich imaginiert, deutet und bewahrt.
Lass uns abschließend noch einen letzten Gedanken ins Spiel brignen: Ich habe oben erwähnt, dass Mythen einen Zweck besaßen.
Es sieht so aus, als würde auch die Philosophie – besonders die religiöse und geschichtliche – ähnliche Aufgaben erfüllen. Auf den ersten Blick strebt sie danach, Wissen zu vermitteln und das Leben zu lenken, doch im Inneren könnte sie Sinn, Trost und Selbsterkenntnis bieten – vielleicht sogar Machtkonzepte fördern.
Oder nutzt die Philosophie – wie etwa die Geschichtsphilosophie [5] – womöglich den Weg, neben der streng rationalen Wissenschaft, Thesen ein wenig ungebundener zu formulieren? Das könnte akzeptabel sein…
Literatur
[1] HERRMANN, Joachim (Herausgeber, in Verbindung mit Hans Quitta, Horst Klengel, Johannes Irmscher und Irmgard Sellnow); Lexikon früher Kulturen · Band 2; Seite 80
[2] PROJEKT GUTENBERG-DE: Hesiod · Theogonie oder Der Götter und Göttinnen Geschlecht.; Übersetzt von Johann Heinrich Voß.
[3] Ödipus: https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96dipus
[4] Paradies-Garten: bibel-online.net; 1. Mose – Kapitel 2
[5] YouTube-Kanal: Jacobin Magazin; „Ist die Geschichtsphilosophie tot? | mit Daniel Martin Feige (Jacobin Talks)“, 30.7.2023 Thema des Interviews: “Der Philosoph Daniel Martin Feige hat mit seinem Buch „Die Natur des Menschen – eine dialektische Anthropologie“ nun eine Verteidigung der Geschichtsphilosophie vorgelegt…”