Bild: Mal was ganz anderes zum Nachdenken. Was braucht wohl mehr Ressourcen in der Herstellung – traditionell ausgelassenes Schweinefett oder industriell raffiniertes Rapsöl? [1]
[Keto][Hausschwein] [Gute Fette, schlechte Fette?]
🐷 Vorweg bemerkt: Wusstest du, dass Vitamin D fast ausschließlich in tierischen Lebensmitteln vorkommt? Pflanzliche Öle liefern praktisch nichts – mit Ausnahme von Pilzen (und selbst dort nur als Vitamin D₂, das der Körper schlechter verwertet).
Schweineschmalz enthält – abhängig von Fütterung und Haltung [2] – zwischen 2 und 10, bzw. nach etlichen Studien bis 190 µg (Mikrogramm) Vitamin D pro 100 g. Zum Vergleich:
- 1 Ei: ca. 2 µg
- 100 ml Vollmilch: ca. 0,1 µg
- 10 g Lebertran: ca. 250 µg
- 100 g Schweinefett: von 2 µg bis zu ca. 190 µg (bei Freilanfhaltung) [3]
Bereits ein Esslöffel Schmalz kann einen relevanten Beitrag zur täglichen Vitamin-D-Zufuhr leisten – besonders im Winterhalbjahr. Vorausgesetzt: artgerechte Tierhaltung, denn Sonne und Fütterung beeinflussen den Gehalt erheblich. [3]
Stell dir vor: Ein Nachmittag auf dem Land, die Pfanne zischt, Bratkartoffeln duften. Auf dem Tisch ein schlichtes Schmalzbrot, gewürzt mit Salz und Majoran. Ein Bild von Bodenständigkeit und Wärme. Und doch – ein Zögern: „Schmalz? Ist das nicht ungesund?“ Ein Reflex, tief eingeprägt durch Jahrzehnte medizinischer Schlagzeilen und fettfeindlicher Ernährungstipps.
Dabei lohnt sich ein zweiter Blick. Schweinefett wurde in Verruf gebracht – häufig ohne sachliche Grundlage. Es ist an der Zeit, diesen Irrtum zu korrigieren.

Der schlechte Ruf: Ein Kind seiner Zeit
In den 1980er- und 90er-Jahren etablierte sich eine Schwarz-Weiß-Malerei in Ernährungsfragen: Fett wurde pauschal zum Feind erklärt. Schlankheit galt als Ideal, tierisches Fett als Rückfall in archaische Essgewohnheiten. Gleichzeitig begann der Siegeszug industriell hoch-verarbeiteter Pflanzenfette – unter dem Etikett „leicht“ und „gesund“.
Diese Perspektive greift zu kurz. Denn Fett ist nicht gleich Fett. Und Fett vom Schwein (ich meine nicht das Fleisch) ist nicht der Übeltäter, als der es oft dargestellt wird – im Gegenteil: Wer sich ketogen ernährt, nutzt genau solche Fette gezielt, um den Körper in den Fettstoffwechsel und in die Ketose zu bringen.
Die innere Struktur: Was in Schweinefett wirklich steckt
- Schmalz besteht aus einer feinen Mischung verschiedener Fettsäuren:
- Rund 45 % einfach ungesättigte Fettsäuren, darunter vor allem Ölsäure – eine zentrale Komponente des Olivenöls.
- Etwa 40 % gesättigte Fettsäuren, die in maßvoller Dosierung nicht automatisch schädlich sind.
- Nur etwa 10 % mehrfach ungesättigte Fettsäuren, was es besonders hitzestabil macht – ideal also zum Braten.
Und dann ein Aspekt, der kaum bekannt ist, aber Gewicht hat:
Schweinefett enthält natürliches Vitamin D.
Ein fettlösliches Vitamin, das für Knochenstoffwechsel, Immunabwehr und psychisches Gleichgewicht essenziell ist. Gerade in den dunkleren Monaten – oder bei einem Lebensstil mit wenig Sonnenexposition – ist dieser Beitrag zur Ernährung von Bedeutung. Pflanzliche Öle liefern hier: nichts.
Transfette? Nicht im Schmalz
Oft wird Schweinefett mit Transfetten in einen Topf geworfen – zu Unrecht. Die problematischen veränderten Fette entstehen in der Regel beim zu heißen Braten von Fetten, die dafür nicht geeinget sind. Sie stehen nachweislich mit Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Verbindung.
Natürliches Schweineschmalz kann jedoch reltiv och erhitzt werden (~180–220 °C ) und die wenigen vorhandenen Formen – etwa konjugierte Linolsäuren – werden teilweise sogar als physiologisch günstig diskutiert.
Es ist also an der Zeit, differenzierter zu denken: Nicht jedes Fett ist gefährlich, nicht jedes pflanzliche Öl ist per se gesund.

Schmalz in der Küche: Ein unterschätzter Klassiker
Manch einer verbindet Schmalz mit Omas Speisekammer – altmodisch, schwer. Doch in der Küche erweist es sich als erstaunlich vielseitig:
- Es verleiht Bratkartoffeln eine unverwechselbare Kruste.
- Es bringt Röstgemüse zum Leuchten.
- Selbst in herzhaftem Gebäck zeigt es Tiefe und Aromatik.
Zudem punktet es durch seine Stabilität bei Hitze – ein klarer Vorteil gegenüber vielen hochverarbeiteten Pflanzenfetten, die bei starker Erhitzung zu oxidieren beginnen.
Wer Wert auf Regionalität legt, findet in handwerklich hergestelltem Schmalz zudem ein Produkt mit Herkunft und Charakter – frei von fragwürdigen Zusatzstoffen.
Kulturelle Konditionierung und kulinarische Realität
Schmalz polarisiert. Für manche klingt es nach Schwerfälligkeit, nach einem Relikt aus der Vorkriegszeit. Doch wer es pragmatisch angeht, wird oft überrascht:
- Ein Löffel ins Pfannengemüse genügt.
- Ein dünner Strich aufs Roggenbrot, garniert mit Schnittlauch – und der Effekt ist klar: Aromatisch, sättigend, ehrlich.
Schmalz aus artgerechter Haltung ist nicht nur kulinarisch überzeugend, sondern ist überhaupt ein uraltes Lebensmittel der Menschen und gehört zu unserer artgerechten Ernährung. Es steht für Verwertung ohne Verschwendung – ein Gedanke, der wieder an Relevanz gewinnt.
Fazit: Mit Maß genossen, ist Schmalz ein Gewinn
Schweinefett ist kein Relikt, sondern ein zu Unrecht vergessenes Lebensmittel. Es ist:
- natürlich reich an Vitamin D,
- stabil beim Erhitzen,
- frei von künstlichen Zusatzstoffen,
- und geschmacklich markant, ohne dominant zu sein.
Die pauschale Ablehnung tierischer Fette hat sich als zu einfach erwiesen. Wer differenziert hinsieht – und genießt – wird feststellen: Schmalz kann mehr als sein Ruf.
Wie ist deine Haltung dazu? Bist du bereit, dem Schmalzbrot eine neue Chance zu geben? Schreib es mir gern in die Kommentare.*
*Auch wenn die Freischaltung der Kommentare auch manchmal einen Tag lang dauert …
Noch zum Schluss im Internet gefunden – „Schmalzbrot mit Porree“
Im Stadt-Wiki Dresden, im Bericht zur Historie der Eilenburger Straße in Dresden-Altstriesen, Anfang 19. Jahrhundert:
«Im Gehöft Nr. 13 stand eine große Linde, unter der die Kinder gern lagen und im Geäst die Vögel beobachteten. […] Ein Hochgenuss für die Kinder war ein Schmalzbrot von den Eltern und eine frisch aus der Erde im Garten gezogene Porreezwiebel [junge Porreestangen], die im Wasser des Wasserfasses schnell gewaschen wurde.» [6]

Quellen und Ergänzungen
[1] Diese Fragestellung ist mein eigentliches derzeitiges Recherche-Thema – „Das Hausschwein in der Subsistenzökonomie: Vom Resteverwertung und ressourcenschone Tierhaltung im Kleinen.“ – wobei das „Fett-Thema“ mitrecherchiert und hier gesondert herausgestellt wurde.
[2] Die Freilandhaltung der Schweine bedingt den hohen Gehalt an Vitamin D. Die Studien [2] erinnern mich direkt an meinen Blogbeitrag über die „Blue Zone – Langlebigkeit der Sarden durch Fleischverzehr?„, also von der Insel, wo Schweine traditionell freilaufend gehalten wurden und teils noch werden (ebenso, wie auf Korsika).
Lies auch: Sardinien, Carne a Carraxiu – Spanferkel aus dem Erdofen
[4] https://www.nutritiontable.com/nutritions/nutrient/
[5] https://web.archive.org/web/20250701085923/ https://de.wikipedia.org/wiki/Vitamin_D
[6] https://www.stadtwikidd.de/wiki/Altstriesen
Haftungsausschluss: Die Inhalte dieses Beitrags dienen der allgemeinen Information und stellen keine medizinische oder ernährungs-wissenschaftliche Beratung im engeren Sinne dar. Sie ersetzen nicht die individuelle Diagnose, Behandlung oder Empfehlung durch qualifizierte Fachkräfte. Wer gesundheitliche Fragen oder Beschwerden hat, sollte sich an Ärzte oder Ernährungsfachleute wenden – idealerweise an solche, die nicht sofort in Ohnmacht fallen, wenn das Wort „tierisches Fett“ fällt.
Die dargestellten Informationen wurden sorgfältig recherchiert und nach bestem Wissen formuliert. Dennoch übernehmen wir keine Haftung für eventuelle Schäden oder Nachteile, die direkt oder indirekt aus der Anwendung der Inhalte entstehen könnten. Die Verantwortung für Ernährung und Lebensweise bleibt – ganz im Sinne der Selbstbestimmung – bei meinen Leserinnen und Lesern 🐖
Thomas Jacob · Erstveröffentlichung: Februar 2025 · Durchgesehen: 28.1.2026


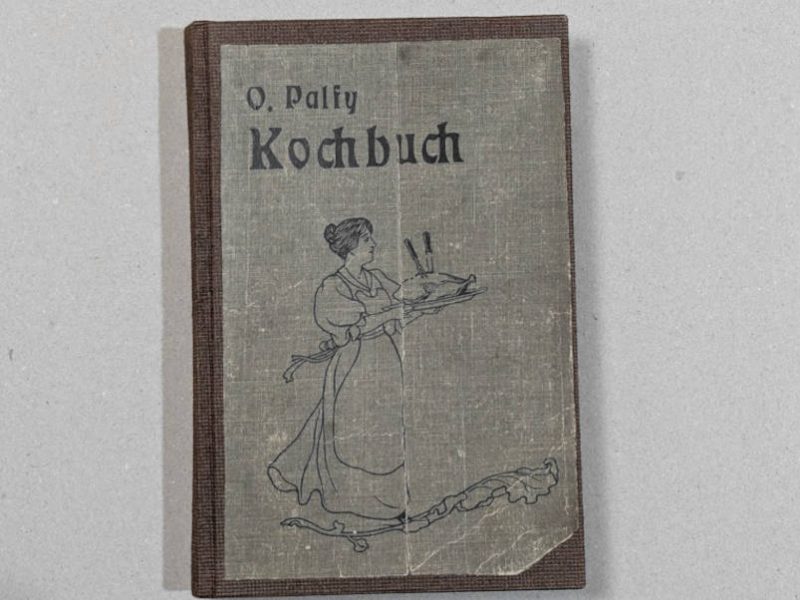
Ich backe immer Schmalzplätzchen nach dem Rezept meiner Oma, die 1898 geboren wurde. Zart, lecker und anschließend kein Sodbrennen.
Und das Rezept 🙂 ???